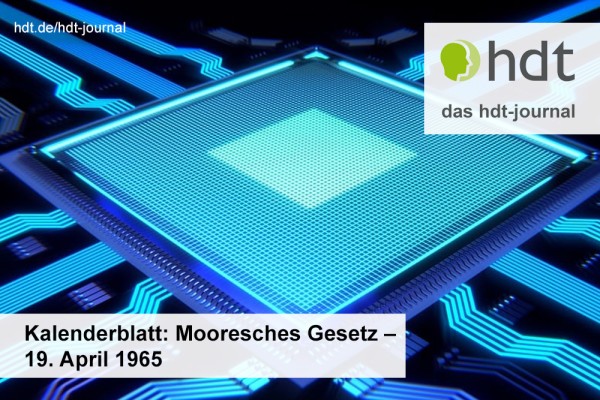Wer darauf hinweist, dass in jeder sogenannten Smartwatch mehr Rechenleistung steckt, als der Crew der Apollo 11 im Jahre 1969 bei ihrer Landung auf dem Erdtrabanten zur Verfügung stand, wird dafür kaum mehr als ein müdes Lächeln ernten. Könnte das daran liegen, dass viele die Fähigkeit zum Staunen verloren haben? Die Begeisterung für die Zukunft war durchaus schon einmal ausgeprägter. Die Medien perpetuieren häufig eine stark pessimistische, ja düstere Weltsicht und bereiten Menschen wie den „Klimaklebern“ eine willkommene Bühne, statt sich mit den unzähligen vorhandenen Ansätzen zu beschäftigen, mit denen sich die meisten Menschheitsprobleme beseitigen ließen.
Hilfreiche Faustregel
Teil des früheren Vertrauens in die technische Entwicklung – womit ausdrücklich nicht naiver Fortschrittsglaube gemeint ist – ist auch die heute vor 58 Jahren erstmals durch den US-Ingenieur Gordon Moore veröffentlichte Faustregel, die besagt, dass sich die Komplexität von integrierten Schaltkreisen regelmäßig verdoppelt. Sie wurde später als „Mooresches Gesetz“ bekannt. Natürlich gab es in der Folge viele unterschiedliche Formulierungen und Deutungen, was vor allen Dingen mit dem angesetzten Verdoppelungszeitraum und der technischen Perspektive zusammenhängt. Abhängig davon, ob man beispielsweise von der Anzahl an Schaltkreisen pro Prozessor oder pro Flächeneinheit spricht, verändert sich das Ergebnis jeweils deutlich.
Unabhängig von den spezifischen zu diskutierenden Details lieferte Moore mit seiner Beobachtung aber eine hilfreiche allgemeine Richtschnur, die uns zuverlässig in das digitale Zeitalter begleitet hat. Und obwohl die Entwicklungssprünge bei künstlicher Intelligenz und Quantencomputern die Fortschritte bei konventionellen Mikroprozessoren in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend überdecken, erinnerten uns zuletzt die gerissenen Lieferketten während der Pandemie und das geopolitisch heikle Thema Taiwan an ihre zentrale Bedeutung für das Funktionieren der heutigen Welt.
Bleibt anzumerken, wie wenig Europa beziehungsweise Deutschland bei dem Spiel in die Waagschale zu werfen hat. Darüber darf man sich dann wirklich Sorgen machen. Was hoffentlich irgendwann – wie schon bei den Themen Klima- und Umweltschutz – in konkretes lösungsorientiertes Handeln mündet.
Autor: Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal, 19. April 2023