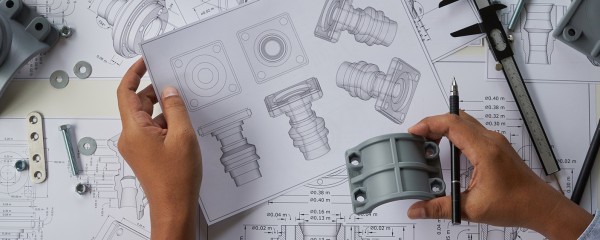Sie ist wieder da: die rote Laterne – Deutschland ist europäisches Schlusslicht. Noch bis vor Kurzem belastete hierzulande primär der unzureichende Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie der Verfall jener aus Beton und Asphalt. Im vergangenen Jahr jedoch erwuchs aus dem Scheitern der Energiepolitik der letzten beiden Dekaden ein zusätzliches gravierendes Problem. Selbst wenn man nicht so weit gehen will, den industriellen Kern unseres Landes bereits als bedroht zu erachten, verlangt die Situation von der Wirtschaft im Vergleich zur ausländischen Konkurrenz das Führen eines „Uphill Battles“.
Wie können Unternehmen trotz zunehmender Standortnachteile, zu denen neben steigenden Kosten eine überbordende Bürokratie gehört, künftig wettbewerbsfähig bleiben? Viel wird fraglos von der Steigerung von Effizienz und Innovationskraft abhängen – angefangen bei der Optimierung von Entwicklung und Konstruktion.
Über Potenziale auf diesem Feld sprachen wir mit dem beratenden Ingenieur Prof. em. Dr. Bernd Klein. Der Träger mehrerer aktiver Patente im Automotive-Bereich und Preisträger des Innovationspreises NoAE sowie zweimalige Preisträger im Wettbewerb „Deutschland – Land der Ideen“ war unter anderem von 1984 bis 2014 Univ.-Professor für Leichtbau an der Universität Kassel.
HDT-Journal: Herr Klein, bereitet Ihnen die gegenwärtige wirtschaftliche Verfasstheit unseres Landes Sorgen?
Bernd Klein: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist schlechter als die Lage. In 2023 ist der IFO-Geschäftsklimaindex zum vierten Mal in Folge zurückgegangen und hat den niedrigsten Stand der letzten Jahre erreicht. Dem steht entgegen, dass trotz der Corona-Krise die Patentanmeldungen bei der EPA nur um ca. 4,5 Prozent gegenüber der Vor-Coronazeit zurückgegangen sind. Deutschland hat danach die zweitmeisten Patentanmeldungen noch vor Japan und China getätigt. Stillstand bei den F&E-Tätigkeiten sieht anders aus.
Ursache für die Schwächephase sind die altbekannten Einflussfaktoren: verkannte Trends, große Rohstoffabhängigkeit, Lieferkettenprobleme, Bürokratisierung, Digitalisierungsdefizite, Arbeitskräftemangel, rückständiges Bildungssystem et cetera. Meine Hoffnung für die nahe Zukunft ruht dabei nicht auf der Großindustrie, sondern auf innovativen KMU, darunter Hidden Champions wie Zeiss, EBM-Pabst, Cellbricks oder FeroLabs, die international wettbewerbsfähig sind und auch bleiben werden.
HDT-Journal: Wie schätzen Sie ganz allgemein das Potenzial zur Kompensation von Wettbewerbsnachteilen durch effizientere Entwicklungsprozesse ein?
Bernd Klein: Die Liste der weltweit größten Unternehmen wird von US-amerikanischen Unternehmen dominiert. Deutsche Unternehmen spielen dabei keine große Rolle. Führende Unternehmen in den USA sind durch disruptive Innovationen wie zum Beispiel iPhone, ALEXA, Smart Watch und Grafikkarten groß geworden, während deutsche Unternehmen sich auf kontinuierliche Innovationen wie beispielsweise optimierte Werkzeugmaschinen konzentrieren. Dies ist eine Frage der Mentalität beziehungsweise Risikobereitschaft, der praktizierten kollaborativen Entwicklungsmethodik und dem Wunsch, schnell zu liefern – mit ersten Pretotyps beim Kunden. Viele Praktiker bemängeln, dass der „deutsche“ Innovationsprozess zu analyselastig sei und viel zu spät in den kreativen Lösungsraum vordringe. Oft ist man dann auch zu spät am Markt und kann den Pionierlohn nicht einfahren.
HDT-Journal: Mit welchen Techniken und Strategien käme man denn auf schnellere Weise zu innovativen Produkten, die auf den Weltmärkten nachgefragt werden?
Bernd Klein: In Deutschland sind vielfältige Aktivitäten in der Begründung einer systematischen Konstruktionsmethodik durchgeführt worden. International haben diese jedoch wenig Beachtung gefunden, weil keine durchschlagenden Erfolge präsentiert werden konnten. Konkurrierend wurden in den USA agile Konzepte entwickelt und deren praktische Relevanz früh in kommerziellen Entwicklungsbüros nachgewiesen. Alle großen Technologieunternehmen, zum Beispiel Apple oder Google, haben in Publikationen dargelegt, dass die umgesetzten disruptiven Innovationen nur deshalb Akzeptanz gefunden haben, weil sich der wirtschaftliche Erfolg schnell nachweisen ließ.
HDT-Journal: Inwieweit unterscheidet sich der Prozess einer Neukonstruktion gegenüber der Weiterentwicklung vorhandener Produkte hinsichtlich der anzuwendenden systemischen Arbeitsweisen?
Bernd Klein: Im wissenschaftlichen Diskurs wird das Problemumfeld Innovation meist überbewertet. Wenn man Innovationen als etwas gänzlich Neues definiert, so haben eigentlich nur 10 Prozent aller F&E-Aufgaben Innovationscharakter. Der große Rest sind Neukonstruktionen, Verbesserungen und Optimierungen unter Nutzung bekannter Prinzipien und Technologien. Dieses Feld deckt im Wesentlichen die VDI 2222 (Konstruktionsmethodik: Konzipieren technischer Produkte) ab. Der hierin aufgeführte Vorgehensplan umfasst die Stufen: Planen, Konzipieren, Entwerfen und Ausarbeiten. Viele Praktiker stehen diesem sequenziellen Abarbeiten skeptisch gegenüber und vermissen die Einbindung der Kunden beziehungsweise deren Input.
Ganz anders verhält es sich bei Scrum und Design-Thinking. Prinzipien sind hier: sich selbst organisierende Teams, übertragen von Verantwortung, Kunde ist Entwicklungspartner, Konzentration auf die wesentlichen Produktanforderungen, strukturiertes Arbeiten in Sprints, tägliche Abstimmung der Ergebnisse, Infragestellung von Bekanntem und stetige Überarbeitung des Prozesses. Die Erfahrung zeigt, dass so Probleme etwa in der Hälfte der Zeit gelöst werden und geringere Ressourcen eingesetzt werden müssen.
HDT-Journal: In Deutschland tat man sich in der Vergangenheit nicht selten schwer, aus smarten Erfindungen Verkaufserfolge zu machen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Bernd Klein: Wenn Produkte am Markt scheitern, ist die geläufigste Erklärung: Man hat zu wenig oder zu spät mit dem Kunden gesprochen. Henry Ford soll gesagt haben: „Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde.“ Es wird dabei unterstellt, dass Kunden keine Visionen haben. Diese Herangehensweise beruht auf einer falschen Fragestellung und in deren Folge auf falschen Rückschlüssen. Natürlich muss ein Kunde in eine Entwicklung eingebunden werden. Leider führt dies oft dazu, dass Entwicklungen verzögert werden und zu spät mit einer hohen Perfektion an den Markt kommen. Ein Scheitern bedeutet dann viel Geld in den Sand gesetzt zu haben.
Der mehrfache Start-up-Gründer Eric Ries ist als Entrepreneur mehrfach gescheitert, weil ihm bei der Entwicklung des absolut perfekten Endprodukts das Geld ausgegangen ist. Erst bei seiner letzten Start-up-Gründung (IMVU) hat sich der Erfolg eingestellt, weil er alles anders gemacht hat als vorher. Von Anfang an hat er externe Personen mit Eigeninteresse eingebunden und diese mit kostenpflichtigen Beta-Versionen versorgt. Er wollte damit sicherstellen, dass qualifiziertes Feedback kommt und eine frühe Anwendung erfolgt, damit ein Geldstrom generiert wird.
Dieses nutzerzentrierte Vorgehen findet sich auch in den agilen Methoden Scrum und Design-Thinking und ist letztlich eine Erfolgskomponente, weshalb viele Unternehmen die Umsetzung im E&K-Bereich forcieren.
HDT-Journal: Dem Thema der künstlichen Intelligenz entkommt man inzwischen nicht mehr. Wie schätzen Sie das Potenzial von KI in den nächsten Jahren bezogen auf den Bereich Konstruktion und Entwicklung ein?
Bernd Klein: Die Historie der KI ist seit den 1990er-Jahren durch ein stetes Auf und Ab gekennzeichnet. Euphorie und Ernüchterung wechselten einander ab. Heute trifft KI auf gute Rahmenbedingungen. Die Programmiersprachen und die Computer werden immer leistungsfähiger. Im Bereich der Ingenieurtätigkeiten ist es denkbar, dass Programme die Varianten- und Änderungskonstruktionen im Zusammenspiel mit CAD/CAM völlig autonom lösen werden. Die Perspektiven für KI sind somit günstig. Der große Durchbruch wird aber erst in einigen Jahren kommen, wenn die Anwendungen nicht überreglementiert werden – Stichwort Ethik-Kommission der EU.
HDT-Journal: Herr Klein, wir danken Ihnen für die umfangreichen und interessanten Ausführungen.
Die Fragen stellte Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal
Hinweis: Über die Seminarangebote des HDT im Bereich Konstruktion und Entwicklung informiert Sie unsere spezielle Übersichtsseite.