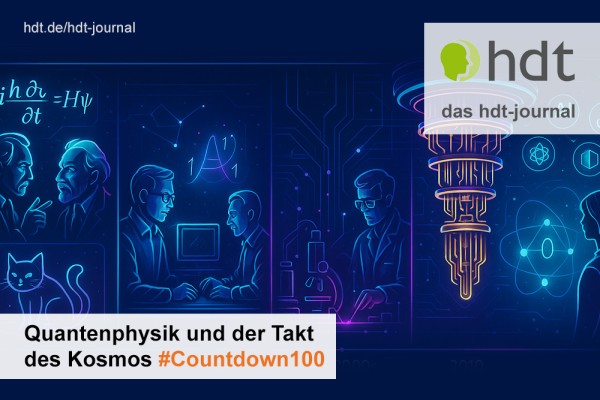In der vorangegangenen Folge der neuen Reihe aus Anlass des kommenden HDT-Gründungsjubiläums ging es mit Milchstraße und Universum um die Anfang des vorigen Jahrhunderts erzielten revolutionären Fortschritte bei der Erforschung der größten Strukturen. Heute widmen wir uns den kleinsten Bausteinen, aus denen unser Kosmos besteht.
Bereits das antike Griechenland kannte die Vorstellung eines unteilbaren Urstoffes. Dem hierfür vor zweieinhalbtausend Jahren geprägten Begriff átomos ist unser Wort „Atom“ entlehnt. Natürlich wissen wir mittlerweile, dass sich Atome selbst aus einem ganzen Zoo von Teilchen zusammenfügen. Ein wichtiger Meilenstein war in dieser Hinsicht die Entdeckung der Kernspaltung durch Otto Hahn und Fritz Straßmann im Jahre 1938. Der Nobelpreisträger Hahn zählt nebenbei zu den vielen berühmten Persönlichkeiten, die beim HDT vorgetragen haben.
Dennoch scheint die subatomare Welt feste, unüberwindbare Grenzen zu kennen, wodurch es nicht unendlich immer kleiner und kleiner geht.
Der Begründer der Quantenphysik setzt dem Sein feste Grenzen
Schon 1899 postulierte Max Planck (der ebenfalls HDT-Gastredner war), dass sich auf der Grundlage der von ihm entdeckten Planck-Konstante Maßeinheiten für Länge, Zeit und Masse definieren lassen, die „für alle Zeiten und für alle, auch ausserirdische und aussermenschliche Culturen“ Gültigkeit besitzen. Die vielleicht bekannteste nach dem Begründer der Quantenphysik benannte Einheit ist die Planck-Länge (10−35 m). Die Planck-Zeit (10−43 s) wiederum ist definiert als die Dauer der Reise des Lichts über die Distanz einer Planck-Länge, was sich spaßeshalber als Inbegriff eines Kurztrips bezeichnen ließe.
Ab den 1950er Jahren ging man davon aus, dass die Annahme der Existenz einer Ausdehnung unterhalb der Planck-Länge keinerlei Sinn ergibt. Zu versuchen, eine solche im Teilchenbeschleuniger nachzuweisen, würde lediglich zur Entstehung Schwarzer Löchern führen. Das folgt aus der Heisenbergschen Unschärferelation, die 1927 – im Jahr der HDT-Gründung – entdeckt wurde. Sie besagt bekanntermaßen, dass im Reich der Quanten die gleichzeitige genaue Bestimmung zweier zueinander komplementärer Eigenschaften wie Aufenthaltsort und Impuls oder Zeit und Energie unmöglich ist.
Die Welt als diskret getaktetes System
Ebenso ein Ding der Unmöglichkeit ist es freilich, sich diese Zusammenhänge im Lichte unserer normalen Alltagserfahrungen vorzustellen. Für den täglichen Gebrauch würde es aber reichen, wenn man sich vor Augen führt, dass Zeit, Raum und Materie im Allerkleinsten auf einem diskret getakteten System aufbauen.
Eine begreifbare Parallele bildet die digitale Informationsverarbeitung aus Nullen und Einsen, die im Gegensatz steht zu dem aus allen möglichen Zwischenwerten bestehenden Kontinuum der erfahrbaren analogen Welt.
Quanteneffekte im Alltag
Der Vergleich taugt zugleich als Überleitung zu jener Anwendung der Quantenphysik, die gegenwärtig wohl die meisten Schlagzeilen macht: Quantencomputing. Langfristig könnten Quantencomputer die Welt stärker auf den Kopf stellen, als es seinerzeit der Transistor (John Bardeen, William Shockley und Walter Brattain, Bell Laboratories, 1947) und der integrierte Schaltkreis (Jack Kilby und Robert Noyce, Texas Instruments, 1958) getan haben.
Relativ große Uneinigkeit herrscht allerdings darüber, ab wann mit einem echten Durchbruch zu rechnen ist. Sind es wenige Jahre oder Jahrzehnte? Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich …
Verfrühte Ängste
Die Idee, Quanteneffekte in der Informationstechnik auszunutzen, hat großen Charme. Anders als herkömmliche Prozessoren, bei denen es sich letztlich um eine schier endlose Aneinanderreihung winziger Stromschalter handelt, verfügen Quantencomputer über mehr mögliche Zustände als an und aus – und können diese zeitgleich einnehmen. Simulationen komplexer Prozesse – Wetter, Verkehrsgeschehen oder Wirkungsweisen von Molekülen im Organismus bei der Suche nach neuen Medikamenten etwa – könnten hiervon in beispielloser Weise profitieren. Auch lässt das Berechnungen praktikabel werden, für die heutige Supercomputer Wochen oder gar Jahre benötigen.
Probleme bereiten jedoch bislang die Fehleranfälligkeit und die zu geringe Stabilität der Informationsträger, sodass gelegentlich geschürte Ängste vor dem künftigen Aushebeln jedweder herkömmlicher Verschlüsselung – beim Bitcoin zum Beispiel – oder einer generellen Machtergreifung der Maschinen eindeutig verfrüht sind.
Alles andere als ein Quantensprung
In der Zwischenzeit sei festgehalten, wie sinnbefreit es ist, große Errungenschaften mit dem inflationär verwendeten Ausdruck „Quantensprung“ zu kennzeichnen. Selbst ein Proton ist trillionenfach größer als eine Planck-Länge. Wer so kurz springt, kommt nicht wirklich schnell voran.
Übrigens wäre das ganz sicher auch nicht im Sinne von HDT-Gründer Heinrich Reisner gewesen. Wie sehr dieser ab den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgrund der Erfindung der modernen technischen Weiterbildung zum allgemeinen Fortschritt und Wohlstand beitrug, lässt sich kaum erahnen. Dementsprechend wird nicht einmal ein Quantencomputer in der Lage sein vorauszuberechnen, was alles erreicht werden kann, wenn sich Menschen fortgesetzt nach dem Reisnerschen Prinzip fächerübergreifend zusammenfinden und ihr Wissen und ihre Talente in die Waagschale werfen, um zu innovativen Lösungen zu kommen.
Autor: Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal, 02.05.2025
Bildhinweis:
Unser Titelbild entstand unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz.