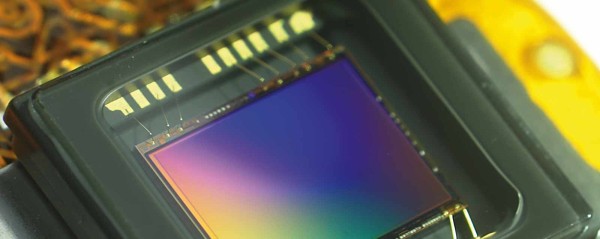Mehr denn je herrscht heute Einigkeit hinsichtlich der Notwendigkeit, Schadstoffe und Verbrennungsprodukte konsequent weiter zu reduzieren beziehungsweise gar nicht erst entstehen zu lassen. Oder – wie im Fall von Carbon Capture and Utilization – einzufangen und unschädlich zu machen respektive zu verwerten. Eine Art von Emission wird jedoch trotz aller Bemühungen um mehr Umwelt- und Gesundheitsschutz bis dato nur unzureichend adressiert: Lärm. Bereits vor Jahren bemängelte das Umweltbundesamt, dass das Bewusstsein für Lärm gesellschaftlich zu wenig ausgeprägt sei. Wer kann davon kein Lied singen? Man denke etwa an Gartenfeste, lärmende Rasenmäher oder die alljährlichen kostenlosen „Laubbläser-Konzerte“, mit denen ganze Siedlungen tyrannisiert werden. Vorzugsweise geschieht all das, wenn sich die Nachbarschaft eigentlich erholen will – zum Beispiel vom Lärm im Beruf. Doch wie heißt es schon in Schillers Wilhelm Tell: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“
Rücksichtnahme hilft bei Schallimmissionen nur bedingt
Die europäische Umweltagentur hat die Zahl der Menschen, die in Europa nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) regelmäßig gesundheitsschädlichem Lärm ausgesetzt sind, auf etwa 20 Prozent geschätzt. Die langfristigen Folgen sind hinreichend gut genug erforscht, um das einen Skandal nennen zu können. Die WHO selbst spricht vom zweitgrößten Umweltfaktor, der die Krankheitslast vergrößert. Auf Platz eins: Luftverschmutzung.
Während in manchen Kontexten Rücksichtnahme der Schlüssel zur Reduzierung von Lärmbelastungen ist, braucht es beispielsweise bei Gewerbe- und Industrieanlagen technische Lösungen. Eine entscheidende Voraussetzung ist hierfür natürlich die genaue Kenntnis der Entstehung und Ausbreitung von Schall sowie der verschiedenen möglichen Schallschutzmaßnahmen und rechtlichen Rahmenbedingungen aus der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm; eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift in der Bundesrepublik Deutschland) und dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), in dem wiederum die TA Lärm ihre rechtliche Grundlage hat. All das spielt nicht zuletzt bei Genehmigungsverfahren eine Rolle. Meist machen diese bei geplanten technischen Anlagen eine schalltechnische Immissionsprognose unverzichtbar, anhand derer sich abschätzen lässt, inwieweit technische und organisatorische Maßnahmen zur Einhaltung von Richtwerten führen und unter welchen Auflagen die Genehmigung erteilt werden kann.
Lärm aus Immissionsschutz- und Arbeitsschutz-Perspektive
Das HDT bietet seit Jahren eine ganze Reihe von Seminaren zu Fragen des Schallschutzes, der Lärmisolierung und der TA Lärm, die sich mit den Grundlagen und Möglichkeiten der Verringerung des Körperschalls (Körperschallisolierung) und der Reduzierung der Körperschallübertragung unter anderem im Maschinen- und Anlagenbau und Bauingenieurbereich beschäftigen. Zum Portfolio gehört ebenfalls der bundesweit staatlich anerkannte Grundkurs zum Erwerb der Fachkunde im Sinne der 5. BImSchV „Immissionsschutzbeauftragte“. Aber auch aus der Arbeitsschutz-Perspektive wird das Thema Lärm bei Deutschlands ältestem Weiterbildungsinstitut behandelt, zum Beispiel im Rahmen der großen jährlichen Arbeitsschutztagung.
Autor: Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal, 14.07.2022