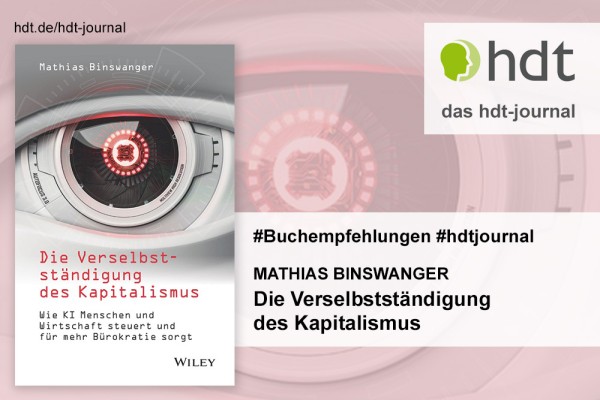Kann man den Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und ihren Anwendungen gegenüber kritisch eingestellt sein, ohne sich den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, „moderne Blasphemie“ zu betreiben, wie Mathias Binswanger es nennt? Offensichtlich ja. Der Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Privatdozent an der Universität St. Gallen hat das mit seinem neuen Buch „Die Verselbstständigung des Kapitalismus“, erschienen im Verlag Wiley-VCH, gerade bewiesen.
Laut NZZ-Ökonomen-Ranking zählt der mehrfache Buchautor zu den einflussreichsten Ökonomen der Schweiz. Sein Wort findet dementsprechend bereits vielerorts Gehör. Gewiss wäre es nicht von Nachteil, wenn sich möglichst viele Menschen neben einem allgemeinen Überblick über Grundprinzipien und Funktionsweise von KI mit Binswangers Hilfe ein Bild von den Implikationen für ihr eigenes Leben und die Gesellschaft machen würden.
Fortschritts-Paradox
Binswangers gleichermaßen erhellendes wie differenziertes Buch wirft – ausgehend von Überlegungen zur digitalen Transformation als Teil der Evolution von kapitalistischen Ökonomien – eine Reihe unausweichlicher Fragen zu den praktischen Folgen für jedermann auf, die durchaus nicht ausnahmslos als erstrebenswert zu bezeichnen sind.
Eine lange vor dem Auftauchen von ChatGPT zum (medialen) Ausdruck gekommene Befürchtung in Verbindung mit KI und fortgeschrittener Robotik ist die, dass unzählige traditionelle Berufe überflüssig werden könnten. Somit gehen die Verheißungen eines Lebens, das von immer mehr Services geprägt sein wird, die in früheren Zeiten den Reichsten vorbehalten waren – Privatsekretär (ChatGPT & Co.), Chauffeur (Robotertaxi beziehungsweise vollautonomes Fahren) et cetera – paradoxerweise mit der unterschwelligen Angst einher, aus dem Erwerbsleben herauszufallen und im Zweifelsfall zu verarmen.
Eine Sorge weniger?
Derlei Sorgen sind, sofern Binswanger Recht behält, wenn nicht unbegründet, so doch zumindest weit übertrieben. Das Verschwinden herkömmlicher Jobs könnte nämlich erneut – wie seit Jahrzehnten beobachtbar – durch neu entstehende Berufsfelder mit großem Personalbedarf kompensiert werden. Dazu gehören Regulierung, Controlling, Organisation und Consulting.
Auf legislativer Seite nimmt das übrigens inzwischen konkrete Formen an. Noch bevor sich das technologisch auf vielen Feldern ins Hintertreffen geratene „Old Europe“ ernsthaft mit dem Wesen und den Chancen von KI befassen konnte, kommen ähnlich wie zuvor bei der Gentechnik reflexartig Pläne zum Errichten regulatorischer EU-Schutzzäune. Diese werden nicht verhindern, dass Fortschritt anderswo in der Welt stattfindet, wodurch sich das Abgehängtsein nur verschärft.
Gefahr für die Freiheit
Damit sollen die von Binswanger angesprochenen unangenehmen Begleiterscheinungen der neuen Technologien keineswegs verharmlost werden, zu denen Gesellschaften und Individuen sich früher oder später werden verhalten müssen. Der titelgebende Begriff „Verselbstständigung“ ist in dem Zusammenhang teilweise sogar eher ein Euphemismus.
Allerdings muss man nicht gleich auf die allseits bekannten Überwachungsstaaten verweisen, um die Gefahren für die (digitale) Souveränität und Freiheit des Individuums aufzuzeigen. Ungeachtet der angenehmen Seiten der bequemen Denk-Unterstützung ließen sich die von Binswanger aufgegriffenen Beispiele der unterschwelligen Manipulation mittels Nudging und der zunehmend perfekteren ökonomischen Verwertung persönlicher Daten auch in westlichen Demokratien als Anzeichen für den Übergang zu einem Überwachungskapitalismus interpretieren.
Glückliche Gutmenschen
Indem Binswanger gar von der Schaffung von „normierten Gutmenschen“ spricht, betritt er mitnichten verschwörungstheoretisches Terrain. Hierbei handelt es sich letztlich um die Perfektionierung und politische Instrumentalisierung von Konzepten, die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts entstanden. Konformismus zu erzielen war von höchstem ökonomischen Interesse. Das garantierte den maximalen Absatz gleichförmiger, günstig zu produzierender Waren. Der massenpsychologische Trick lag darin, eintönige Gleichförmigkeit mithilfe der Werbung als Quell individueller Glückseligkeit auszugeben.
Eine vergleichbare Illusion schaffen mehr und mehr verschiedene KI-Assistenten, die sich scheinbar als reine wohlwollende Diener um unser Wohlergehen bemühen. Dass sie das – wie Binswanger richtig folgert – nicht sind, ja nicht einmal sein können, ergibt sich schon allein aus den riesigen Investitionssummen in die benötigten Infrastrukturen. Diese wirken sich gegenwärtig massiv kurstreibend auf eine kleine Zahl von Aktien ausrüstender Unternehmen wie Nvidia oder Super Micro Computer aus. All das muss sich irgendwann amortisieren.
Gefährliche Abhängigkeit
Demgemäß zeigt der Autor in einem eigenen Kapitel auf, welchen Interessen es dient, dass (Konsum-)Entscheidungen nach und nach an Algorithmen übertragen werden. Aus der Einsicht, dass wir es hier mit keiner Wohltätigkeitsveranstaltung zu tun haben, leitet sich eine der wichtigsten Erkenntnisse des Buches ab. „Es ist nicht intelligent, sich von künstlicher Intelligenz abhängig zu machen“, bringt Binswanger die Quintessenz auf den Punkt.
Wie wahr! Das gilt aber für die Digitalisierung insgesamt. Man denke an die Bedrohung, die von Angriffen im Rahmen der hybriden Kriegsführung ausgeht. Oder – wesentlich banaler – an die beispiellosen weltweiten IT-Ausfälle vom 19. Juli 2024 infolge eines einzelnen fehlgeschlagenen Updates des IT-Sicherheitsunternehmens Crowdstrike. Hierdurch waren über Business-Prozesse hinaus in mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehbarer Weise Teile der kritischen Infrastruktur wie zum Beispiel Krankenhäuser beeinträchtigt respektive lahmgelegt!
Riskantes Experiment
Wie sich hieraus andeutet, warten jenseits des Verwaltens von KI offenbar zahlreiche weitere Herausforderungen, die im Sinne der Resilienz mit der Überwachung künftiger IT-Architekturen zu tun haben und sich als Jobmotoren erweisen könnten. Andererseits muss kritisch hinterfragt werden, ob die gänzliche Abschaffung bestimmter analoger Dinge und Verfahrensweisen (wie die Möglichkeit der Bezahlung mit Bargeld) nicht ein allzu riskantes Experiment darstellen würde.
Ganz nebenbei ist der schleichende Verlust von kulturellen Techniken wie beispielsweise Lesen und Schreiben ein weiterer Punkt, über den nachgedacht werden muss. Wem das übertrieben kulturpessimistisch vorkommt, möge sich daran erinnern, was nach Einführung des Taschenrechners aus dem Kopfrechnen wurde. Bloß sind es dieses Mal weitaus mehr Fähigkeiten und Kompetenzen, die an elektronische Helferlein delegiert werden.
Einzigartiger Ansatz
Alarmismus ist das eine, eine ruhige sachliche Debatte mit dem Potenzial, kluge, praktikable Antworten zu finden, ist das andere. Am vorliegenden Buch (von dem Binswanger selbst sagt, dass dessen Thema manchen als eine Art Dystopie erscheinen könnte) gefällt gut, dass es viel zu viele grundlegende Aspekte verhandelt, als dass Platz bliebe für düstere Schreckensvisionen, von denen schon mehr als genug existieren.
Weit spannt Binswanger den Bogen, der von konstituierenden Merkmalen kapitalistischer Wirtschaften über die Auseinandersetzung mit der digitalen Wiedergeburt der sozialen Physik bis zur aufschlussreichen Herleitung einer neuen Controlling-Bürokratie aus dem New Public Management reicht. Ein Ansatz, der einzigartig ist.
Fazit: Erkenntnisgewinn unvermeidbar
Während mit dem Siegeszug von KI Wohlstandsverluste für den arbeitenden Teil der Bevölkerung genauso wenig automatisch vorprogrammiert sind wie Gefahren für den Fortbestand der Menschheit (etwa aufgrund der vermeintlichen Unkontrollierbarkeit autonomer Waffensysteme), darf vorausgesetzt werden, dass man ohne kluge menschliche Entscheidungen auch in Zukunft nicht wird auskommen können.
Eine Vorbedingung dafür ist freilich Fachwissen. Mindestens ebenso elementar sind eine breite Wissensbasis und ein großer Erfahrungsschatz – Voraussetzungen für das stärker denn je gefragte vernetzte Denken und eine sozusagen synoptische Weltsicht. In dieser Hinsicht ist Binswangers Buch von großem Wert und Nutzen. Es geht nicht zuletzt auf zahllose Sachverhalte ein, an die die meisten im Zusammenhang mit KI noch gar nicht gedacht haben werden. Ein umfassender Erkenntnisgewinn ist also nachgerade die unvermeidbare Konsequenz der Lektüre. Daher eine klare Leseempfehlung.
Mathias Binswanger
Die Verselbstständigung des Kapitalismus
Wie KI Menschen und Wirtschaft steuert und für mehr Bürokratie sorgt
Wiley-VCH, Weinheim
ISBN: 978-3-527-51152-5
288 Seiten, Hardcover
https://www.wiley-vch.de
Autor: Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal, 23.07.2024