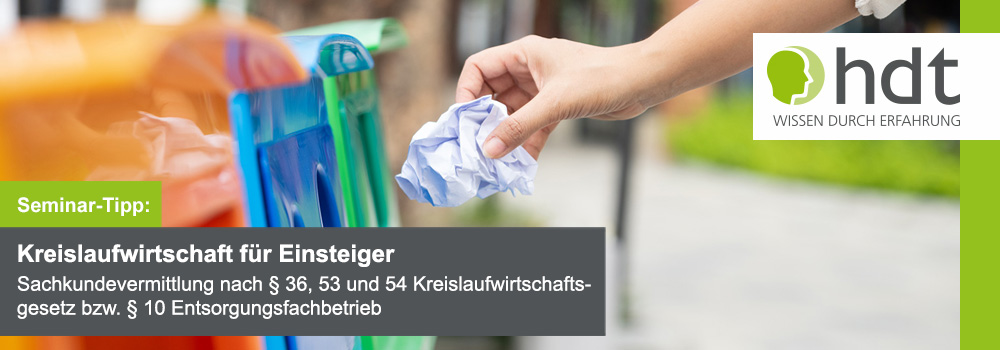Nicht neu, aber alles andere als von gestern: Als ein zukunftsweisender Ansatz in der Gestaltung wirtschaftlicher Prozesse entstand die Kreislaufwirtschaft im vergangenen Jahrhundert als Reaktion auf die lineare Wirtschaftsweise, welche Ressourcen nach und nach erschöpft. Erste Ansätze wie Recycling und Abfallvermeidung wurden bereits in den 1970er-Jahren entwickelt. Mehr Fahrt nahm die Sache in den 1990er-Jahren auf, als das Umweltbewusstsein spürbar wuchs.
Im folgenden Beitrag gehen wir auf die Grundprinzipien der Kreislaufwirtschaft ein, betrachten einige der bisherigen Meilensteine und erörtern das künftige Potenzial.
Kreislaufwirtschaft unterscheidet sich fundamental von der traditionellen linearen Wirtschaftsweise. Während das herkömmliche Modell stark vereinfacht auf dem Nehmen, Produzieren, Verbrauchen und Wegwerfen basiert, verfolgt die Kreislaufwirtschaft einen geschlossenen Kreislauf. Er soll die Lebensdauer maximieren und den Abfall minimieren. In einer Welt, die von Umweltproblemen und zunehmender Ressourcenknappheit geprägt ist, bietet die Kreislaufwirtschaft gegenüber der Linearwirtschaft einen technisch gangbaren und ökonomisch vernünftigen Ausweg. Als transformative Kraft birgt sie sogar das Potenzial, positive Auswirkungen auf die Gesellschaft zu entfalten.
Im Zentrum der Kreislaufwirtschaft steht das Konzept der Ressourceneffizienz. Anstatt Produkte nach ihrer Nutzungsdauer im Sinne der Wegwerfwirtschaft in Deponien zu entsorgen beziehungsweise zu verfeuern, strebt die Kreislaufwirtschaft danach, Materialien wiederzuverwenden, zu recyceln und in den Produktionsprozess zurückzuführen. Dieser Ansatz reduziert die Abfallmenge erheblich und trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und somit die Umweltauswirkungen von Wirtschaftstätigkeiten zu minimieren.
Cradle-to-Cradle statt Cradle-to-Grave: Definition der Kreislaufwirtschaft
Ein wesentliches Merkmal der Kreislaufwirtschaft ist die Betonung des Cradle-to-Cradle-Prinzips. Im Gegensatz zum Cradle-to-Grave-Ansatz, bei dem Produkte am Ende ihrer Lebensdauer quasi verloren gehen, strebt die Kreislaufwirtschaft danach, geschlossene Kreisläufe zu etablieren, in denen Waren nach ihrer Nutzung in den Produktionszyklus zurückkehren können. Dieser Ansatz fördert die Schonung natürlicher Ressourcen und die Innovation in der Produktgestaltung und Herstellung.
Die Kreislaufwirtschaft erstreckt sich über verschiedenste Sektoren – von Produktion und Konsum bis hin zur Abfallwirtschaft. Ihre Prinzipien können auf unterschiedlichste Warengruppen und Felder angewendet werden, zum Beispiel Elektronik, Textilien, Bauwesen oder Energie. Der ganzheitliche Charakter dieses Ansatzes spiegelt sich in der Notwendigkeit wider, die Art und Weise der Herstellung von Waren und ihre Behandlung am Ende des Lebenszyklus zu überdenken.
Insgesamt beschreibt die Kreislaufwirtschaft einen Wandel in der Produktions- und Konsumkultur, der eine evolutionäre Antwort auf die Herausforderungen von Ressourcenknappheit und Umweltbelastungen darstellt. Dieser Ansatz bietet über ökologische Vorteile hinaus das Potenzial, die Wirtschaft nachhaltiger und widerstandsfähiger zu gestalten.
Meilensteine der Kreislaufwirtschaft
Werfen wir einen Blick auf Meilensteine der Kreislaufwirtschaft – und damit implizit zugleich auf die Herausforderungen, die es zu bewältigen galt und vielfach nach wie vor gilt. Die folgenden Personen und Schlüsselereignisse haben die Entwicklung und Implementierung der Kreislaufwirtschaft ebenso wie die öffentliche Wahrnehmung des Themas entscheidend beeinflusst.
Die Grundlagen der Kreislaufwirtschaft wurden bereits im 19. Jahrhundert gelegt. Damals begannen erste Vordenker und Visionäre damit, Alternativen zur linear ausgerichteten Wirtschaft zu erkunden. Ab den 1970er-Jahren rückte das Bewusstsein für Umweltauswirkungen und Ressourcenknappheit in den Vordergrund. Eine Zäsur bildete der erstmals möglich gewordene Blick auf die Erde aus dem Weltall beziehungsweise vom Mond aus. Fotos der US-amerikanischen Apollo-Missionen, welche die Erde als kleine, verletzliche blaue Kugel inmitten der Leere des Alls zeigten, sind in ihrer Wirkmacht beispiellos.
Unter dem Eindruck von Veröffentlichungen wie „Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit“ von 1972 oder der 1977 von US-Präsident Jimmy Carter in Auftrag gegebenen Umweltstudie „Global 2000“ gewannen Ideen wie die Abfallvermeidung und Wiederverwendung an Bedeutung, wenngleich zunächst in einem begrenzten Kontext. Fahrt nahm die weltweite Recycling-Bewegung auf, als erstmals in verschiedenen Ländern Recyclingprogramme ins Leben gerufen und entsprechende Gesetze verabschiedet wurden.
Raumschiff Erde
Was die Entwicklung der Theorien der Kreislaufwirtschaft betrifft, kommt man nicht an Namen wie Karl Ludwig von Bertalanffy vorbei. Der überaus einflussreiche Biologe und Systemtheoretiker befasste sich unter anderem mit Fragen des Wachstums und den energetischen Wirkmechanismen offener und geschlossener Systeme – belebte und unbelebte. Großen Einfluss hatte ebenfalls der US-Ökonom Kenneth Ewart Boulding mit seinem 1966 (also noch vor Apollo 11) veröffentlichten Aufsatz „The Economics of the Coming Spaceship Earth“.
Zu den weiteren wichtigen Vordenkern der Kreislaufwirtschaft zählen beispielsweise Allan Victor Kneese mit seinen Pionierarbeiten im Bereich Umweltökonomik aus den 1960er-Jahren oder David W. Pearce und R. Kerry Turner mit ihrer Publikation „Economics of Natural Resources and the Environment“ von 1990, in der sie den Wechsel vom herkömmlichen linearen Wirtschaften hin zu einem zirkulären Wirtschaftssystem – und das Potenzial zur Minimierung von Ressourcen – im Detail beschreiben.
Remaking the Way We Make Things
Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist das 2002 veröffentlichte gemeinsame Buch des Architekten William McDonough und des Chemikers Michael Braungart: „Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things“. Darin wird der Fokus auf das geänderte Design von Produkten gelegt, die nicht nur recycelbar, sondern auch positiv für die Umwelt sind. Vorbild des Ende der 1990er-Jahre von McDonough und Braungart entworfenen Cradle-to-Cradle-Prinzips sind biologische Kreisläufe und das Grundprinzip der Natur, keinerlei Abfallstoffe zu erzeugen, die nicht von Organismen resorbiert und verstoffwechselt werden können.
Zu den maßgeblichen bisherigen politischen Initiativen zählt der EU-Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft, erstmals beschlossen im Jahre 2015. Dieser beinhaltete 54 konkrete Maßnahmen. Die vier Jahre später erfolgte Evaluierung wies den Aktionsplan als Erfolg aus, woraufhin 2021 weitere Maßnahmen zur Förderung von „grünem Wachstum“ und Wettbewerbsfähigkeit verabschiedet wurden.
Schon deutlich früher, nämlich 1975, betonte die EU-Abfallrahmenrichtlinie die Notwendigkeit der Kreislaufwirtschaft. Außerdem hat sich mittlerweile die EU mit ihrer Richtlinie 2008/98/EG den Übergang zur Kreislaufwirtschaft zum Ziel gesetzt. Explizit wird von den Mitgliedstaaten die Förderung nachhaltiger Produktions- und Konsummodelle und einer langlebigen Gestaltung und Reparierbarkeit verlangt. In Deutschland wird die EU-Richtlinie durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz umgesetzt.
Kreislaufwirtschaft als Wirtschaftsmotor?
Kommen wir zu den Potenzialen der Kreislaufwirtschaft für wirtschaftliches Wachstum. Die sind mindestens aus zweierlei Gründen von Belang. Die Um- respektive Durchsetzung kreislaufwirtschaftlicher Prinzipien wäre ein schwieriges Unterfangen, würden sich hiermit nicht erkennbar volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Vorteile und Chancen verbinden. Und tatsächlich können Unternehmen, die sich auf kreislaufwirtschaftliches Arbeiten einlassen, innovative Geschäftsmodelle entwickeln, welche die eigene Wettbewerbsfähigkeit steigern und darüber hinaus langfristiges Wachstum fördern.
Ressourceneffizienz als Kostenersparnis
Die Umstellung auf einen kreislaufwirtschaftlichen Ansatz trägt dazu bei, den Ressourcenverbrauch zu optimieren und Abfall zu minimieren. Durch effizientere Produktionsprozesse und den Einsatz recycelter Materialien können Unternehmen Kosten senken und kompetitiver werden. Überdies macht die Umstellung auf ressourceneffiziente Praktiken Unternehmen unabhängiger von volatilen Rohstoffmärkten.
Neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen
Die Kreislaufwirtschaft eröffnet Raum für innovative Geschäftsmodelle, die über den Verkauf hinausgehen. Dienstleistungen wie Reparatur, Wartung und Upcycling können neue Einnahmequellen sein. Unternehmen können zudem vermehrt auf Product-as-a-Service-Modelle (PaaS; Produkte als Dienstleistung) umstellen. Hierbei sind Konsumierende nicht Eigentümer, sondern lediglich Nutzer. Dieser Ansatz verbessert die Langlebigkeit von Produkten und kann langfristige Kundenbeziehungen schaffen.
Entwicklung neuer Märkte durch Recycling und Ressourcenrückgewinnung
Der Recyclingsektor bietet zum einen die Möglichkeit, Abfall zu reduzieren. Zum anderen lassen sich Rohstoffe aus bereits genutzten Materialien zurückgewinnen. Dies ermöglicht die Entwicklung neuer Märkte für recycelte Produkte und schafft gleichzeitig zusätzliche Wertschöpfung in der Recyclingindustrie. Des Weiteren bietet die steigende Nachfrage nach recycelten Materialien Chancen für Unternehmen, die in innovative Technologien zur Materialaufbereitung investieren. Das Ganze geht Hand in Hand mit verändertem Produktdesign, das die sortenreine Trennung von Produktkomponenten zum Ziel hat.
Reputation und Kundenbindung
Verbraucherinnen und Verbraucher legen zunehmend Wert auf nachhaltige Praktiken von Unternehmen. Die Umstellung auf Kreislaufwirtschaftsmodelle stärkt die Reputation von Unternehmen und erhöht die Kundenbindung. Firmen, die sich aktiv für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung einsetzen, erlangen Wettbewerbsvorteile und festigen ihre Marktposition.
Autor: Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal, 14. Februar 2024