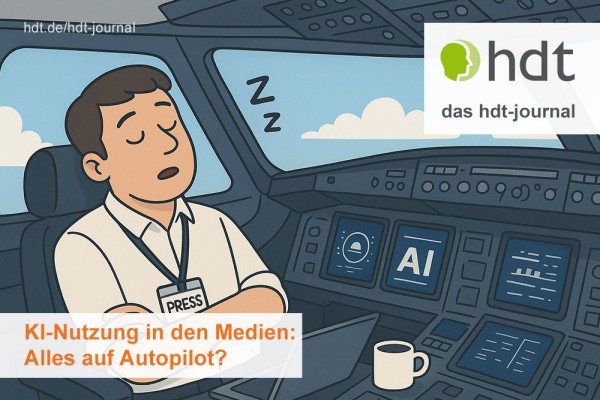Es klingt verführerisch: Man kontrolliert ein Medium – zum Beispiel ein Wirtschaftsmagazin – dessen Einnahmen aus (Online-)Abonnements und Werbung seit Jahren stagnieren, was schon zu grauen Haaren geführt hat. Nun aber ist man plötzlich in der Lage, zumindest die Kosten spürbar zu senken. Wer braucht schließlich noch eine große und teure Redaktion mit vielen Mitarbeitenden, wo KI-Anwendungen Content inzwischen wie im Rausch gratis ausspucken?
Die Wahrheit der medialen KI-Nutzung sieht anders aus
Wie es wirklich um den Einsatz künstlicher Intelligenz in den Medien steht, hat jetzt die Universität Zürich untersucht – mit interessanten Ergebnissen. So nutzt in unserem Nachbarland eine klare Mehrheit in den Redaktionen KI-Tools. Primär geht es dabei indes um unterstützende Tätigkeiten und sehr viel weniger um die Erstellung von Inhalten als man meinen würde. Dafür gibt es gute Gründe.
Insgesamt erachten 63 Prozent der Schweizer Journalistinnen und Journalisten künstliche Intelligenz als hilfreich für die eigene Arbeit. Genutzt wird sie laut Silke Fürst, die für die Studie verantwortlich zeichnet, vorwiegend für Transkriptionen, das Optimieren von Texten oder die Findung passender Titel. Kaum jemals würden hingegen komplette Inhalte generiert. Das erklärt sich aus den Erfahrungswerten mit den neuen Werkzeugen.
Ein zeitliches Nullsummenspiel
Rund ein Drittel der in der Studie befragten 730 Medienschaffenden aus den drei großen Sprachregionen der Schweiz gab an, dass sich die Qualität eigener Beiträge durch die Nutzung von KI verbessere. Doch ein noch größerer Anteil (38 Prozent) ist der Ansicht, dass das kaum oder gar nicht der Fall ist. Und nicht nur das: Wer mit KI arbeitet, spart auf der einen Seite Zeit, muss allerdings auf der anderen Seite eine Menge Zeit für das Verifizieren der Resultate einplanen.
Alles ohne Gewähr?
Hier kommt der Haken: Ein Teil der Befragten – immerhin rund ein Fünftel – räumt ein, überhaupt nicht die Zeit dafür zu haben, KI-generierte Informationen zu kontrollieren oder durch eigene Quellen oder Auskunftspersonen zu ergänzen (24 Prozent).
Nachdenklich macht ebenso das folgende Ergebnis: Die Mehrheit der Befragten verriet, dass in ihren Redaktionen keine systematisierten Maßnahmen der Qualitätssicherung existieren oder sie diese nicht kennen würden. Weitere 15 Prozent berichteten, dass der redaktionelle Einsatz von KI bereits zu Fehlern geführt habe. Vier von fünf Medienschaffenden sind außerdem davon überzeugt, dass KI im Journalismus viele ethische Fragen aufwirft.
Standards gefordert
Eingedenk all dessen nimmt es nicht Wunder, dass mehr als 80 Prozent der Auffassung sind, dass es branchenweiter Standards zur Kennzeichnung von KI bedarf. Dem Publikum, das ohnehin eine skeptische Haltung hat, würde dies erlauben, den Einsatz von KI besser nachzuvollziehen.
Und noch über einige andere Zahlen sollte man gründlich nachdenken: 61 Prozent der Medienschaffenden aus der Schweiz gehen davon aus, dass der journalistische KI-Einsatz die Verbreitung von Falschinformationen begünstigt, 68 Prozent rechnen mit einer allgemeinen Angleichung der Inhalte.
Vertrauen und Relevanz in Gefahr
70 Prozent befürchten sogar, dass KI das Vertrauen des Publikums gefährdet. Bleibt hinzuzufügen, dass man sich, wo die Leserschaft mit denselben Werkzeugen Artikel mit Leichtigkeit selbst erstellen kann, überdies Gedanken machen sollte, ob nicht ein weitgehender Verlust der Relevanz droht, wenn frühere Alleinstellungsmerkmale wegfallen.
Ein anderer beunruhigender Trend ist die wachsende Abhängigkeit von Tech-Unternehmen, die größtenteils nicht in Europa beheimatet sind und sich somit nahezu jedweder Kontrolle entziehen. Eine große Mehrheit der Journalistinnen und Journalisten (75 Prozent) hat das als Problem erkannt.
Von alten Hasen lernen?
Die Studie aus Zürich hat darüber hinaus gezeigt, dass ältere Medienschaffende, was die KI-Nutzung betrifft, gegenüber jüngeren Kolleginnen und Kollegen wesentlich zurückhaltender sind. Früher hätte man gesagt, sie seien zu konservativ im Denken, nicht flexibel genug, festgefahren und unmodern.
In der heutigen Zeit empfiehlt es sich, manche Dinge anders zu betrachten. (Lebens-)Erfahrung und das über Jahrzehnte aggregierte (Fach-)Wissen älterer Journalistinnen und Journalisten sind zwar keine Vollkaskoversicherung, jedoch ein immer wichtiger werdender Schutz vor Halbwahrheiten, Hoaxes oder den sogenannten KI-Halluzinationen. Schließlich bleibt es auch im KI-Zeitalter dabei: Wer nichts weiß, muss alles glauben.
Autor: Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal, 24.09.2025
Weitere Informationen:
Universität Zürich
www.uzh.ch
Bildhinweis:
Unser Titelbild entstand unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz.