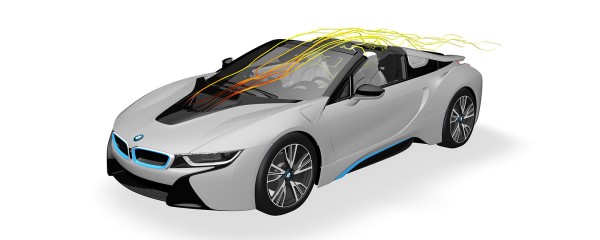Die Beschäftigung mit der Fahrzeug-Aerodynamik ist nahezu so alt wie das Automobil selbst. So gab der Mailänder Graf Marco Ricotti schon 1914 – ein Jahr nach Einführung der Fließbandfertigung durch Henry Ford und Charles E. Sorensen – den Bau einer an ein Luftschiff erinnernden Limousine in Auftrag. Der „Aerodinamica“ getaufte tropfenförmige Entwurf erreichte rund 140 Stundenkilometer – doppelt so schnell wie der Bestseller jener Tage, das Modell T von Ford. Die anschließende Serienproduktion verhinderte der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Allerdings erwiesen sich die große Wärmeabgabe und Lärmentwicklung des im Innenraum liegenden Motors ohnehin als Pferdefuß. Komfort, Schnelligkeit und Effizienz unter einen Hut zu bringen, blieb späteren Generationen vorbehalten.
Der Form geopferte Funktion: Rumplers Tropfenwagen
Mit dem damaligen aerodynamischen Ideal der Tropfenform experimentierte ebenfalls der in Wien geborene Konstrukteur Edmund Rumpler. Sein Tropfenwagen von 1919 wies mit 0,28 einen sogar nach heutigen Maßstäben sehr guten Luftwiderstandsbeiwert auf. Zudem setzte er bei der Radaufhängung neue Maßstäbe, führte gewölbte Scheiben in den Fahrzeugbau ein und lieferte mit dem Einbau des Antriebsaggregats als Mittelmotor die Blaupause für viele spätere Rennsportwagen. Kommerzieller Erfolg war dem Tropfenwagen indes nicht beschieden. Der Motor war zu schwach und mit fehlendem Beifahrersitz und mangelnder Lademöglichkeit war der Form einfach zu viel Funktion geopfert worden.
Infokachel 1:
Wofür steht der cw-Wert?
Der cw-Wert – auch Widerstandsbeiwert, Widerstandskoeffizienten oder Strömungswiderstandskoeffizienten – ist das Maß des Strömungswiderstands eines von einem Fluid (im physikalischen Sinn: Flüssigkeit, Gas, Plasma) umströmten Körpers. Grundsätzlich gilt: je geringer der cw-Wert ausfällt, desto weniger Luftwiderstand bietet ein Objekt wie zum Beispiel eine Fahrzeugkarosserie.
Immerhin sorgte die Verwendung als Requisite in Fritz Langs „Metropolis“ für die cineastische Unvergänglichkeit des Rumpler-Tropfenwagens – obschon die perfekt in die dystopische Szenerie passenden Fahrzeuge am Ende zerstört werden. Tatsächlich erhalten geblieben sind von dem unverwechselbaren Gefährt lediglich zwei Exemplare. Sie sind im Deutschen Museum in München und im Deutschen Technikmuseum in Berlin zu besichtigen.
Rennsport und Fahrzeug-Aerodynamik
Noch vor Ricottis und Rumplers Beiträgen wurde im Rennsport versucht, mithilfe von strömungsgünstigen Fahrzeugkarosserien Vorteile zu erzielen. 1911 beispielsweise führte der US-Rennfahrer Ray Harroun die Monoposto-Bauform ein, die wir bis heute aus Formel 1 & Co. kennen. Waren Rennwagen zuvor schwere Zweisitzer, in denen jeweils ein Mechaniker neben dem Rennfahrer saß, um das rückwärtige Geschehen zu verfolgen, reüssierte Harroun beim ersten Indianapolis 500 mit seinem leichten und windschnittigen Einsitzer. Ein Rückspiegel ersetzte den Beifahrer, auch wenn überliefert ist, dass Harroun sich nach dem Rennen beklagte, dieser sei aufgrund der starken Vibrationen praktisch unwirksam gewesen.
Zu den beeindruckendsten frühen Fahrzeug-Aerodynamik-Erfolgen zählt zweifellos der Typ C von Auto Union, mit dem Bernd Rosemeyer 1937 ein Geschwindigkeitsrekord von 406,32 km/h gelang. Der cw-Wert des Sechzehnzylinder-Rennwagens betrug 0,237. Zum Vergleich: Das knapp ein halbes Jahrhundert später von der Motorpresse zum „Aerodynamik-Weltmeister“ gekürte Mittelklassemodell Audi 100 C3 kam „nur“ auf einen Wert von 0,3.
Vom Versuchsfahrzeug zum windschnittigen Familienauto
Dass bei Personenwagen noch deutlich bessere Ergebnisse möglich sind, bewies Jahrzehnte vor dem Audi 100 der sogenannte „Schlörwagen“ (auch als „Göttinger Ei“ bekannt) des deutschen Ingenieurs Karl Schlör von Westhofen-Dirmstein. Die Form des 1939 an der Aerodynamischen Versuchsanstalt (AVA) in Göttingen auf minimalen Treibstoffverbrauch hin entwickelten Experimentalfahrzeugs mit Aluminiumkarosserie für bis zu sieben Passagiere lehnt sich an Flugzeugtragflächen an. Die Öffentlichkeit konnten das lang herabgezogene Heck und die pausbäckige Front in ästhetischer Hinsicht seinerzeit nicht überzeugen. Zum Trost gilt der Schlörwagen dank eines klar unter 0,2 gemessenen cw-Wertes als windschnittigstes Familienauto aller Zeiten.
Infokachel 2:
In welchem Zusammenhang stehen Luftwiderstand und Fahrzeugverbrauch?
Als Faustregel gilt: Verdoppelt sich die Fahrgeschwindigkeit, vervierfacht sich der Luftwiderstand eines Fahrzeugs. Bei normaler Ortsgeschwindigkeit (50 km/h) ist der Luftwiderstand bereits größer als der Rollwiderstand der Reifen und wirkt sich infolgedessen am stärksten auf Verbrauch und Reichweite aus.
Acht Jahrzehnte danach reichte ein cw-Wert von 0,20 für einen Aerodynamik-Weltrekord aus. Der Mercedes-Benz EQS, eine elektrisch angetriebene Limousine der Oberklasse, setzte sich 2021 bei straßenzugelassenen Serienfahrzeugen an die Spitze. Doch wie wichtig ist die Aerodynamik noch für die künftige Fahrzeugentwicklung?
Quo vadis, Fahrzeug-Aerodynamik?
Gegenwärtig kommt gleich aus zwei Richtungen neuer Schwung in das Thema Fahrzeug-Aerodynamik. Zum einen machen Klimadiskussion und CO2-Gesetzgebung Maßnahmen seitens der Hersteller zur Senkung von Flottengrenzwerten notwendig, zum anderen zahlt darauf die Reichweite-Problematik bei der Elektromobilität ein. Zwar stehen die Batterien bei Elektrofahrzeugen im Fokus, die Entwicklung strömungsgünstigerer Karosserien darf als Lösungsansatz jedoch nicht unterschätzt werden.
Die Spitzenwerte bei Serienfahrzeugen der letzten Jahre geben Wolf-Heinrich Hucho Recht. Der frühere Versuchsingenieur bei Volkswagen und Autor eines der Standardwerke zur Fahrzeug-Aerodynamik – zugleich erster Leiter der 1978 gegründeten HDT-Tagung Fahrzeug-Aerodynamik – wies bereits auf Potenziale für eine Halbierung des cw-Wertes hin, als ein Widerstandsbeiwert von 0,4 bei Pkw noch völlig normal war.
Infokachel 3:
Beispielhafte cw-Werte für einige populäre Fahrzeuge aus der Vergangenheit und Gegenwart
In Klammern angegeben sind jeweils die Produktionszeiträume.
Ford Model T (1908 bis 1927): 0,9
Citroën 2CV (1949 bis 1990): 0,5
VW Käfer (1938 bis 2003): 0,48
VW Golf I (1974 bis 1983): 0,41
VW Golf VII (2012 bis 2017): 0,29
Tesla Model Y (seit 2020): 0,23
Mercedes EQS (seit 2021): 0,20
Vorgenannte Werte, die unter anderem auf Wikipedia veröffentlicht wurden, sind zum Teil mit Vorsicht zu genießen. Nicht immer wurden in der Vergangenheit für Tests echte Fahrzeuge eingesetzt. Bei der Durchführung von Tests mit Modellen ergeben sich teilweise deutliche Abweichungen.
Autonomes Fahren und Fahrzeug-Aerodynamik
Wagen wir zum Schluss noch einen Ausblick: Früher oder später dürfte sich mit dem zu erwartenden Siegeszug echten autonomen Fahrens (Vollautomatisierung gemäß Level 5) die Rolle des Automobils grundlegend verändern. Das mobile Wohnzimmer respektive Homeoffice wird man ohne Rücksicht auf Faktoren wie Übersichtlichkeit (oft schon heute eine vernachlässigte Größe) und Handlichkeit gestalten können. Primäres Entwicklungsziel wird dann die Darstellung maximalen Fahrzeugkomforts, während ähnlich wie bei Pferden das selbstgelenkte Automobil vermutlich eines Tages nur noch im Rahmen sportlicher Aktivitäten in Erscheinung treten wird.
Demgemäß wagte Ferdinand Porsche 1984 die Vorhersage, dass das letzte Auto, das man baut, ein Sportwagen sein wird. „Normale“ Fahrzeuge mit Straßenzulassung werden hingegen nicht einmal mehr zwingend Fenster benötigen. Und erst recht wird man nicht freiwillig weiterhin hinter einem Armaturenbrett eingeklemmt sitzen. Daraus sollte sich genügend Spielraum für das Experimentieren mit völlig anderen Karosserieformen ergeben – auch im Sinne des Erzielens ungeahnter Verbesserungen hinsichtlich der Fahrzeug-Aerodynamik.
Autor: Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal, 31. Mai 2023