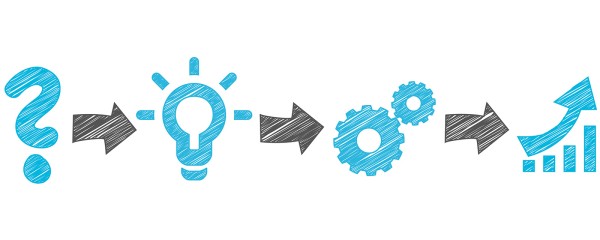Die Anfänge der modernen Industriegesellschaft und industriellen Massenproduktion sind durch das Bestreben charakterisiert, möglichst gleichförmig in höchster Stückzahl zu produzieren. Die Standardisierung erlaubte die Versorgung der Bevölkerungen mit erschwinglichen Waren zu geringen Herstellungskosten bei gleichzeitig hohen Margen.
Vom Massengeschmack zu Mass Customization
Lange Zeit verfolgte man im Marketing dementsprechend das Ziel, Konformität (Massengeschmack) als erstrebenswert erscheinen zu lassen. Auf den Punkt bringt es das bekannte Zitat Henry Fords: „Jeder Kunde kann sein Auto in jeder beliebigen Farbe haben, solange es schwarz ist".
Trotzdem die Masse der Fahrzeuge auch heutzutage in der Farbe Schwarz (oder höchstens in Grau oder Silber) gekauft wird, befinden wir uns längst im Zeitalter der Mass Customization (ebenso als kundenindividuelle Massenproduktion oder individualisierte Massenfertigung bekannt). Unternehmen aus allen Branchen werben folglich zunehmend damit, ihre Produkte weit über Farbstellungen hinaus in unzähligen Varianten anbieten zu können – und richten dafür immer umfangreichere Online-Konfiguratoren ein, die bei der Zusammenstellung des individuellen Mixes an Eigenschaften und Funktionen helfen.
Die Anstrengungen, die zur Verwirklichung des großen „Wunschkonzertes“ nötig sind, bleiben der Öffentlichkeit gemeinhin verborgen. Es ist überhaupt keine Kleinigkeit, möglichst viele unterschiedliche Produkte anzubieten und dennoch Komplexität und Kosten im Griff zu behalten. Variantenmanagement ist der Schlüssel dazu. Für den Unternehmenserfolg wird es immer unverzichtbarer, dieses gut zu beherrschen.
Wie trägt Variantenmanagement zum Unternehmenserfolg bei?
Das Variantenmanagement ist ein durchaus schwieriger Balanceakt zwischen Marktvielfalt (was die Außenwirkung betrifft) auf der einen sowie Wirtschaftlichkeit und Prozessbeherrschbarkeit (Innenperspektive) auf der anderen Seite. Die Komplexität zu reduzieren, ohne dass sich Nachteile für das Produktportfolio und damit für die Kundenzufriedenheit ergeben, ist also unternehmerisch von größter Bedeutung.
Erreichen lassen sich individuelle Produkte oder Produktvarianten durch smartes Variantenmanagement auf verschiedene Art und Weise. Zum gewünschten Ergebnis können beispielsweise modulare Baukästen oder Plattformstrategien führen, bei denen ein möglichst großer Teil standardisiert ist. Trotz einer potenziellen Legion an Produktvarianten lassen sich Kosten und Mehraufwand für Entwicklung, Produktion, Logistik und After-Sales so deutlich begrenzen.
Welche Gründe gibt es für Variantenvielfalt?
Zwar ist der anhaltende Trend zu individuellen Produkten, mit denen sich Lebensgefühle oder die Persönlichkeit ausdrücken lassen, ein wichtiger Grund für Variantenvielfalt. Doch nicht immer sind es spezifische Wünsche der Verbraucher, die hierfür sorgen. Gesetzliche Regelungen für verschiedene Länder oder Märkte können ebenfalls Treiber von Variantenvielfalt sein. Man denke nur an Links- und Rechtslenker-Fahrzeuge, jeweils ausgelegt für Länder mit Rechts- oder Linksverkehr.
Module als Kostensenker
Ein Beispiel aus den 1970er-Jahren, aus dem man noch heute lernen kann: Um den Aufwand für die marktspezifische Anpassung gering zu halten, ließ man sich bei British Leyland für die von 1976 bis 1986 produzierte Mittelklasse-Modellreihe Rover SD1 einen bemerkenswerten Trick einfallen. Mithilfe eines spiegelsymmetrischen Cockpits, das in zwei gleich großen vorbereiteten Öffnungen auf der linken und rechten Seite entweder das Lenkrad oder eine Lüftungsdüse aufnahm, entfiel die Notwendigkeit zweier getrennter Varianten. Die stets gleiche Instrumententafel wiederum wurde als Modul konzipiert, das wahlweise links oder rechts über dem Lenkrad aufgesteckt wurde.
Sieht man von Problemen auf vielen weiteren Ebenen wie etwa der Qualitätssicherung ab, so ist der Rover SD1 zumindest hinsichtlich des beschriebenen Teilaspektes ein Muster in Sachen Kostensenkung durch Variantenmanagement beziehungsweise Modularität. Der Ansatz zeigt, wie sich aus einer überschaubaren Menge von Bausteinen günstig mehrere Varianten herstellen lassen.
Hätte Variantenmanagement die traditionelle britische Automobilindustrie retten können?
Kommen wir noch einmal zu dem 1968 durch Firmenzusammenschlüsse entstandenen Großkonzern British Leyland zurück. Leider konnte die beschriebene clevere Designlösung den Niedergang der traditionellen britischen Automobilindustrie allein genauso wenig aufhalten wie die Verstaatlichung im Jahre 1975. Dafür war die Wettbewerbsfähigkeit unter dem Strich zu gering, was an mangelnder Effizienz, Innovationskraft, Fertigungsqualität sowie einem in Mitleidenschaft geratenen Image lag.
Besonders schwer wog die Unfähigkeit, teure Redundanzen zu beseitigen. Professionelles Variantenmanagement hätte – bei entsprechender Einsicht – helfen können, das Ruder herumzureißen. Das hätte bedeutet, die Modellpalette zu bereinigen, die äußerlich nahezu identische, indes separat konstruierte und hergestellte Modelle der einzelnen Konzernmarken enthielt. Dem standen unter anderem interne Rivalitäten und Versuche des Wahrens alter Besitzstände im Weg.
Variantenmanagement am Beispiel Elektromobilität
Wie es anders geht, zeigen die Überlebenden der großen Umbrüche der letzten Jahrzehnte. Konzerne wie Volkswagen oder BMW wissen, wie sich auf der Grundlage einer zeitgemäßen Plattformstrategie für die Kundschaft auf effiziente und kostengünstige Weise eine Vielzahl unterscheidbarer Angebote darstellen lassen.
Noch anspruchsvoller als in der Vergangenheit wurde es nach der Einführung von Elektrofahrzeugen. Eine zentrale Frage lautet: Produziert man getrennt in neuen Fabriken für Elektromobilität oder parallel im selben Werk wie für Verbrenner? So oder so eine Herausforderung für das Variantenmanagement.
Auf flexible Architektur gebaut
Das entscheidende Stichwort lautet hier „asymmetrisch“, denn bekanntermaßen ist einerseits die Komplexität und Anzahl der Bauteile bei herkömmlichen Fahrzeugen geringer. Andererseits erfordert schon die Unterbringung der Batterien Änderungen am Basis-Set-up.
Bei BMW zum Beispiel fing man vor anderthalb Jahrzehnten damit an, Elektroautos für den Volumenmarkt auf eigenständigen Plattformen zu entwickeln und herzustellen. Später ging man zu Architekturen über, welche die Produktion von Modellen mit unterschiedlichen Antriebsarten auf denselben Fertigungslinien zuließen, wofür man den Begriff CLAR (Cluster Architecture) erfand. Das Plus in puncto Flexibilität ist nicht zuletzt deswegen vorteilhaft, weil so sehr viel schneller auf eine veränderte Nachfrage reagiert werden kann.
Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe
Eines darf beim Thema Variantenmanagement nicht außer Acht gelassen werden. Wer verschieden wertige Produktofferten machen will, sollte bei der Steigerung der Kosteneffizienz durch Gleichteile vorsichtig sein. Es lauern nämlich Zielkonflikte.
Konkret kann die Kundenwahrnehmung von Qualität und Exklusivität ab einem gewissen Maß beeinträchtigt, wenn – um beim Beispiel Automobil zu bleiben – bei Dingen wie Schaltern, Displays oder Türverkleidungen im High-End-Modell der Abstand zu Einsteigermodellen nicht gewahrt bleibt. Das geht so weit, dass die Kundschaft sich beim klaren Erkennen des Baukastenprinzips betrogen fühlen kann. Zumal der Rückschluss auf die Gesamtqualität eines Produktes bei Nicht-Fachleuten logischerweise ganz wesentlich über derlei – vermeintlich – oberflächliche Merkmale erfolgt.
Vorsicht vor Badge-Engineering
Daraus folgt, dass es zwischen sichtbaren und unsichtbaren Gleichteilen zu trennen gilt. Bei Strukturteilen, Kabelbäumen und Steckverbindern, Steuergeräten et cetera sind Gleichteile sinnvoll. Bei Bedienelementen und für den Komfort und die unmittelbare Qualitätsanmutung verantwortlichen Elementen eher nicht.
Richtig herausfordernd wird das Ganze dadurch, dass idealerweise zusätzlich zur Unterscheidbarkeit über alle Produkte hinweg eine gemeinsame Ästhetik als Teil der Markenidentität zu existieren hat. Nicht jedoch eine „Konzern-Ästhetik“ – sonst drohen im Falle einer Mehr-Marken-Strategie die typischen Gefahren des sogenannten Badge-Engineering: Verwechslungsgefahr und Markt-Kannibalisierung. Das alles wurde oft und nicht selten erfolglos ausprobiert. Sogar über Konzerngrenzen hinaus, was im Hinblick auf Komplexität und Projektaufwand eine Klasse für sich ist.
Steigert Variantenmanagement die Qualität oder ist Variantenvielfalt ein Qualitätsrisiko?
Insgesamt muss man sich überlegen, ob maximale Produktvielfalt in jedem Fall das beste Konzept ist – oder ob der (Marketing-)Fokus nicht stärker auf Produktqualität als wesentliches Alleinstellungsmerkmal zu legen ist. Das führt abschließend zu einer bedeutsamen Grundsatzfrage: Verbessert sich durch Variantenmanagement per se die Qualität? Oder ist umgekehrt Variantenvielfalt mit Qualitätsrisiken verbunden?
Wer auf eine kurze Antwort in Form von einer Art Merksatz Wert legt, dem kann gesagt werden: Nicht die Zahl der Varianten ist das Problem, sondern die Beherrschbarkeit, weswegen tatsächlich beides möglich ist – Qualitätsverbesserung und Risiko. Vorteile, die das Variantenmanagement für die Produktqualität bietet, liegen definitiv in der Standardisierung von Komponenten und Modulen.
Mehr Qualität dank weniger Komplexität
Wer Gleichteile mit hoher technischer Reife nutzt, die in großen Serien erprobt sind, macht vieles richtig. Überdies wird die Qualitätskontrolle durch die Verringerung der Komplexität vereinfacht und besser skalierbar, da man weniger Varianten im Blick behalten muss. Dass das wirtschaftlich gesehen hilft, ist ein angenehmer Nebeneffekt.
Die zuvor genannten und die zusätzlichen Vorteile bei Dokumentation und Nachverfolgbarkeit – oder aufgrund des Vermeidens von unklaren Abhängigkeiten und Qualitätsunterschieden – sollten die sich auf der anderen Seite ändernden Auswirkungen eventueller Rückrufe (welche dann größere Stückzahlen betreffen) mehr als ausgleichen.
Autor: Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal, 16.07.2025
Bildhinweis:
Unser Titelbild entstand unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz.