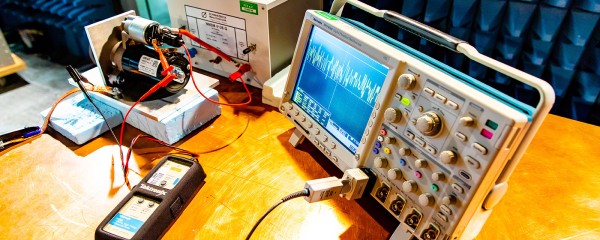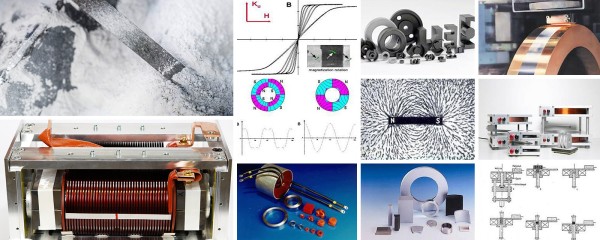Ohne Übertreibung lässt sich sagen: Magnete halten unsere moderne Welt zusammen. Von Lautsprechern über Elektromotoren bis hin zu Windrädern und Großkraftwerken läuft nichts ohne die nach der griechischen Landschaft Magnesia benannten Körper beziehungsweise Stoffe. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass viel Klärungsbedarf existiert rund um die Themen Magnettechnik, Magnetwerkstoffe und Magnetauslegung.
Nachfolgend präsentieren wir – primär im Hinblick auf den Bereich Elektrotechnik – einige der am häufigsten an uns gerichteten Fragen.
Bei der Beantwortung half uns Dr. rer. nat. Martin Grönefeld, Magnetfabrik Bonn GmbH (www.magnetfabrik.de).
Welches sind die wichtigsten Magnetwerkstoffe?
Bei magnetischen Werkstoffen unterscheiden wir die weichmagnetischen Werkstoffe, die auf ein äußeres Feld mit einer Änderung ihrer Magnetisierung reagieren, von den hart- oder dauermagnetischen Werkstoffen, welche unabhängig vom äußeren Feld magnetisch bleiben.
Die magnetische Härte, ausgedrückt als Koerzitivfeld, kann sich je nach Werkstoff um mehr als das Millionenfache unterscheiden.
In beiden Gruppen gibt es die günstigen Ferrite, eine keramische Werkstofffamilie, und spezielle metallische Werkstoffe, die immer Eisen, Kobalt, Nickel oder auch Mangan enthalten.
Welche physikalischen Eigenschaften sorgen dafür, dass bestimmte Magnetwerkstoffe besonders gut geeignet sind für spezifische Anwendungen?
Ein niedriges Koerzitivfeld wird bei induktiven Anwendungen wie Transformatoren, Drosseln, oder Relais benötigt.
Hohe Koerzitivfelder sind bei Magnetwerkstoffen für Motoren, Generatoren, Haftmagneten, bei der magnetischen Ansteuerung für die Positionssensorik oder bei stromlos felderzeugenden Systemen nötig.
Wie hat sich die Entwicklung von Magnetwerkstoffen in den letzten Jahren verändert und wie beeinflusst das die Elektrotechnik?
Seit Magnete erstmals in Elektromotoren eingesetzt wurden, hat sich ihre Stärke, ausgedrückt als Energieprodukt des Werkstoffes, über viele Größenordnungen gesteigert. In den 1980er-Jahren wurden dann die Seltenerdmagnete entwickelt. Viel stärkere Magnete wird es mit der heutigen Technik nicht geben. Dafür haben sich die Anwendungen deutlich erweitert.
Heutzutage ist die Magnetstärke in Traktionsmagneten (das heißt in Motoren höchster Leistungsdichte wie sie beispielsweise in der Elektromobilität zum Einsatz kommen) maßgeblich.
Neuere Anwendungen beispielsweise in der Sensorik, in Mikromotoren oder in der Messtechnik erfordern aber eher eine mechanische Präzision, Reproduzierbarkeit und Prozessfähigkeit sowie Robustheit gegenüber Störeinflüssen. Magnete in Kunststoffbindung erfüllen diese Anforderungen – frei nach dem Motto: „Genauer statt Power.“
Können Sie uns Einblicke in die neuesten Entwicklungen bei der Herstellung und Verarbeitung von Magnetwerkstoffen geben?
In den Grundlagen dreht sich vieles um die Optimierung der Eigenschaften in den bekannten Materialgruppen. Die Suche nach gänzlich neuen Werkstoffen orientiert sich regelmäßig an den sogenannten Heusler-Legierungen oder aber an Legierungen von Übergangsmetallen, die ohne Metalle der Seltenen Erden auskommen.
Spannende Entwicklungen drehen sich auch um neue Systeme wie raffinierte Topologien sowie um die Nutzung moderner Produktionsverfahren, wozu der 3D-Druck zählt.
Wer ist Martin Grönefeld?
Dr. rer. nat. Martin Grönefeld studierte von 1987 bis 1990 Physik. Auf seine Diplomarbeit zu Magnetismus (intermetallische Verbindungen und Legierungen) folgte das Verfassen seiner Promotionsarbeit zum Thema „Magnetischer Härtungsmechanismus schnell erstarrter Legierungen von Neodym, Eisen und Bor“ am Institut für Festkörperforschung, MPI Stuttgart, mit der anschließenden Promotion an der Universität Stuttgart. 1990 stieg Grönefeld in das in dritter Generation geführte familieneigene Unternehmen Magnetfabrik Bonn GmbH (gegründet 1932) ein, wo er 1991 die technische Leitung übernahm und seit 1994 als Geschäftsführer fungiert.
Der Fokus der Magnetfabrik Bonn liegt heute auf der Entwicklung und Produktion von kunststoffgebundenen Dauermagneten und Magnetsystemen am Standort Deutschland mit der Überzeugung, dass eine qualitätsvolle und nachhaltige Fertigung von Produkten in Europa möglich ist.
Neben der unternehmerischen Tätigkeit engagiert sich Martin Grönefeld weiterhin für wissenschaftliche und gesellschaftliche Themen und tritt zudem durch die Einreichung von Patenten in Erscheinung, beispielsweise zum 3D-Druck von Magneten oder dem Aufbau spezieller Messtechnik. Die Leitung der Expertengruppe Sensormagnete in der Projektgruppe zum VDA-Entwurf „Hartmagnete“ sowie Veröffentlichungen und Bücher zum Thema Magnetismus sollen ebenfalls nicht unerwähnt bleiben.
Weitere Informationen:
www.magnetfabrik.de
Welche Herausforderungen gibt es hinsichtlich der Auswahl und Verwendung von Magnetwerkstoffen in elektrischen und elektronischen Systemen?
Da es sich hier meist um Massenprodukte handelt, ist die Wirtschaftlichkeit eine der größten Herausforderungen. Wenn es um „Made in Germany“ geht, sind hoch automatisierte Prozesse vonnöten um eine wirtschaftliche Fertigung darstellen zu können.
Aber auch die Reproduzierbarkeit (oder in der Sprache der Qualitätstechnik ausgedrückt: die Prozessfähigkeit der Herstellung in komplexen Systemen) ist maßgeblich. Hier sticht zum Beispiel der Spritzguss positiv hervor.
Welche Rolle kommt Magneten bei der Leistungsoptimierung beziehungsweise in Sachen Energieeffizienz von Elektromotoren und Generatoren zu?
Bei weichmagnetischen Werkstoffen sind geringe Hystereseverluste und Wirbelstromverluste neben der Sättigungsmagnetisierung extrem wichtig. Bei den Permanentmagneten ist die magnetische Stärke, das heißt das Energieprodukt auch bei höheren Temperaturen maßgeblich. Hier kommt man teilweise ohne die stärksten Seltenerdmagnete nicht aus.
Kunststoffgebundene Magnete helfen bei der Motorregelung durch eine optimale Positionserkennung, beispielsweise bei elektronisch kommutierten Motoren. Hier ist die Magnetstärke weniger ausschlaggebend.
Wie wirken sich Umweltaspekte und das Thema Nachhaltigkeit auf die Auswahl und Verwendung von Magnetwerkstoffen aus?
Bei der Energieumwandlung, wie sie bei Motoren und Generatoren eine Rolle spielt, dreht sich vieles um den Wirkungsgrad. Grundsätzlich erlauben starke Magnetwerkstoffe kleinere und effizientere Maschinen.
Auf der anderen Seite ist die Gewinnung und Verarbeitung von Seltenerdmetallen sehr energieintensiv. So gilt auch hier ein sparsamer und besonnener Umgang mit den Ressourcen.
Welches sind die aktuellen Trends in der Anwendung von Magnetwerkstoffen für neue Technologien wie Elektromobilität und erneuerbare Energien?
Derzeit steht die Frage im Vordergrund, ob Traktionsmotoren in Kraftfahrzeugen oder Generatoren in Windkraftanlagen künftig ohne Seltenerdmagnete auskommen können. Hier gibt es viele Ideen und Konzepte. Man darf auf die Entwicklung gespannt sein.
Wie sieht die Zukunft der Magnetwerkstoffe in der Elektrotechnik aus, insbesondere im Hinblick auf Innovationen und neue Anwendungen?
Da die Zahl der unterschiedlichen Anwendungen riesengroß ist, gibt es natürlich auch auf der einen Seite laufend neue Anforderungen und auf der anderen Seite neue Lösungen. In Wissenschaft und Forschung werden diesbezüglich große Anstrengungen unternommen, da allen Akteuren die (wirtschaftliche) Bedeutung des Themas bewusst ist.
Welche Empfehlungen haben Sie für in der Elektrotechnik Tätige in Bezug auf das Thema Magnetwerkstoffe?
Erst einmal ist ein gutes Verständnis der Zusammenhänge entscheidend. Gemessen an ihrer tatsächlichen Bedeutung spielen Magnetwerkstoffe in der Ausbildung eine zu geringe Rolle. Aber auch die regelmäßige Fort- und Weiterbildung im Sinne des lebenslangen Lernens ist ein Muss für alle, die vorne mit dabei sein wollen.
Im Hinblick auf die konkreten Inhalte ist eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis sowie ein interdisziplinärer Ansatz einer der Schlüssel für das möglichst schnelle Weiterkommen.
Sie bekommen nicht genug vom Thema Magnettechnik und Magnetwerkstoffe?
Im HDT-Journal finden Sie passend hierzu einen weiteren lesenswerten Beitrag:
Ein anziehendes Thema – Magnetwerkstoffe als Grundpfeiler moderner Technik
Bildhinweis:
Unser Titelbild entstand unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz.