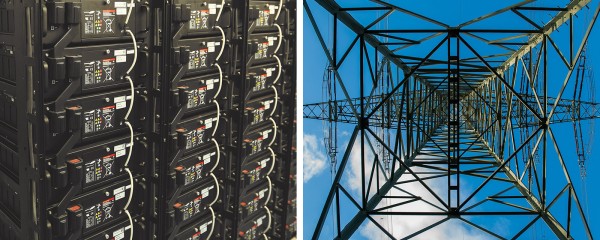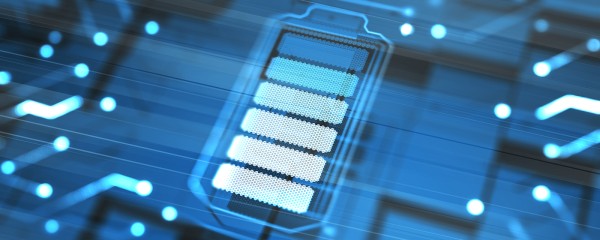Der Umbau der Netze und auch der Schutztechnik ist in vollem Gange. Der hohe Anteil volatiler Einspeisung (Windenergie, Solarenergie) erfordert große Anstrengungen zur Netzstabilität. Energiespeicher (auch Batteriespeicher) sowie exakte Vorhersagen spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang sind:
- Grundlagen Netzberechnung Strom
- Netzanbindung
- Netzrückwirkungen
- Power Quality
- Mittelspannungsschaltanlagen
- Transformatoren
- Trafostationen
- Energiekabel
- Leitungen
- Instandhaltung
- Netzberechnung
- HGÜ Hochspannungsgleichstromübertragung
- Netzstationen
- Hochspannungsschaltanlagen
- Leitungsbau
- Energiespeicher
- Netzschutz
- Schutztechnik
- V2G Vehicle-to-grid
- bidirektionales Laden
- Batteriespeicher
- Energiespeicher
- stationäre Lithium Ionen Speicher
- Batterietag NRW
- Batterietagung
- Kraftwerk Batterie
- Batterie
- Energiespeicher
- Batterie
- Waserstoff
- Wärmespeicher
- Stromspeicher
- Akkumulatoren
- Gas
- Druckluftspeicher
- Schwungrad
- Lithium Ionen
- Energiespeichertechnologie
- Energiespeichersysteme.
Das Haus der Technik bietet dazu die passenden Seminare und Weiterbildungen an.
Unser umfangreiches Seminar- und Tagungsangebot im Bereich der elektrischen Energieübertragung (Anlagen/Netze) finden Sie detailliert auch auf den Seiten zur Elektrotechnik hier.
Alle Seminare zur Batterietechnik (Batterie) finden Sie immer hier: www.hdt.de/batterietechnik.
„Erneuerbare Energien – gut und schön – aber es fehlen die Speicher! Ohne Speicher machen erneuerbare Energien keinen Sinn!“ So oder so ähnlich haben Sie sicherlich die Debatte um die Energiewende und erneuerbare Energien selbst erlebt. Es gibt aber kein Energiespeicherproblem, es gibt eher die Qual der Wahl zwischen einer Vielzahl von Flexibilitäts- und Speicheroptionen.
Die Speicher, die wir für die Energiewende brauchen, sind bereits vorhanden. Technologisch ist das Speicherproblem gelöst. Es gibt ausreichende Kapazitäten in Deutschland, in Europa und weltweit. Es ist auch kein Herausstellungsmerkmal erneuerbarer Energien, dass hier Speicher zum Einsatz kommen müssen. Die Energieversorgungssysteme aller Zeiten haben immer auf Energiespeicherung beruht, lediglich die Perspektive und die verwendeten Technologien ändern sich. Bis heute baut unsere Energieversorgung fast vollständig auf gespeicherter Energie auf. Während wir in dem Energiesystem, welches wir gerade versuchen hinter uns zu lassen, vornehmlich Primärenergie speichern, werden in einer erneuerbaren Energieversorgung eher Strom und Endenergie gespeichert.
Die Speicherung von elektrischer Energie ist eine Aufgabe so alt wie die Existenz von Stromnetzen. Zur Aufrechterhaltung von Spannungs- und Frequenzstabilität in engen Grenzen im Netz sind zum Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage schnell reagierende Speicher notwendig.
Optionen zur Speicherung elektrischer Energie in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeugung
Klassisch wird diese Aufgabe von Pumpspeicherkraftwerken erfüllt. Durch die bereits heute im deutschen Netz signifikante Einspeisung von Strom aus fluktuieren-den, regenerativen Energiequellen steigt der Bedarf an schnell regelbaren Kraft-werken oder entsprechenden Speichersystemen. Einem Spitzenbedarf im deutschen Netz von etwa 75 GW und einem Leitungsbedarf von knapp 50 GW in den Nachtstunden steht bereits eine installierte Leistung von 15 GW aus Windkraftwerken gegenüber, die rund 5 % des jährlichen Strombedarfs liefern. Während derzeit eine Speicherung noch durch optimale Verteilung durch Stromnetze vermieden werden kann, ist dies bei einer höheren installierten Leistung nicht mehr möglich. Neben der schnellen Regelreserve kann aber auch der Stromhandel an der Strom-börse mit einer Ausnutzung der Preisdifferenz zwischen Schwachlastzeiten und Hochlastzeiten ein betriebswirtschaftlich interessantes Einsatzgebiet von Speichern bilden. Daneben werden auch Speichertechnologien für autonome Stromversorgungssysteme benötigt, die in technischen Bereichen z. B. für Sensoren oder Mobilfunkstationen oder im Bereich der ländlichen Elektrifizierung für die Basiselektrifizierung mit „Solar Home“-Systemen oder Dorfstromversorgungen eingesetzt werden. In diesem Beitrag sollen das Potential und der technische Stand verschiedener Speichertechnologien für den Einsatz in Stromnetzen diskutiert werden. Es wird deutlich, dass für einen weiten Bereich von Leistungsanforderungen und Energie-speicherkapazitäten Technologien vorhanden sind. Allerdings muss je nach spezifischen Anforderungen die geeignete Technologie gewählt werden; eine Universal-technologie, die alle Anforderungen erfüllt, gibt es nicht. Dabei können auch thermische Energiespeicher dazu beitragen, Energie effizient zu nutzen und dabei auf eine Speicherung elektrischer Energie zu verzichten. Stromgeführte Kraft-Wärme-Kopplung mit thermischen Speichern können Strom genau dann liefern, wenn der entsprechende Bedarf besteht.
Motivation des Einsatzes von Speichern in Netzen
Speicher in elektrischen Netzen sind im Prinzip nahezu so alt wie die großen Stromnetze selber. Da Strom als solcher nicht gespeichert werden kann, müssen Angebot und Nachfrage zu jedem Zeitpunkt exakt ausgeglichen sein. Um dies zu gewährleisten, wird eine aufwändige Einsatzplanung für den Kraftwerkspark vorgenommen, der sich dafür aus einer geeigneten Mischung von Grundlast-, Mittellast- und Spitzenlastkraftwerken zusammensetzen muss. Da aber alle Kraftwerke abgesehen von der Sekundenreserve, die aus vorhandenem Gasüberschuss oder der Rotationsenergie von Turbinen und Generatoren genommen wird, relativ lange Zeiträume bis zum Erreichen der Nennleistung benötigen, sind zusätzliche schnell einsetzbare Speicher notwendig. Diese müssen immer dann aktiviert werden, wenn der reale Verbrauch von der Prognose abweicht oder wenn ungeplant ein Kraftwerk vom Netz geht. Neben diesem Einsatz von Speichern zur Netzstützung auf oberster Ebene, gibt es auch die Speicher, die eine Versorgungsqualität direkt beim Verbrauch sicherstellen. Diese Speicher sind in unterbrechungsfreie Strom-versorgungsanlagen eingebaut und müssen innerhalb von etwa 10 ms auf Abweichungen von den Sollwerten für Spannung und Frequenz im Netz reagieren können. Dadurch wird der Ausfall oder eine Beeinträchtigung der Verbraucher verhindert. Insbesondere die immer höhere Abhängigkeit von Computeranlagen in allen Bereichen des privaten und des öffentlichen Lebens macht deren Absicherung gegen Stromausfälle oder Schwankungen in der Power Quality notwendig.
Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer
ISEA Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe RWTH Aachen
Lehrstuhl für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik, RWTH Aachen University