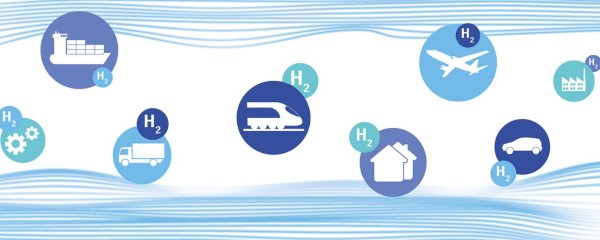Nach einem zumindest nicht völlig geschmeidigen Start hat sich die 25. Bundesregierung ans Werk gesetzt. Der Koalitionsvertrag werde nun solide und überzeugend abgearbeitet, hört man aus der CDU-Fraktion. Sollte der schwarz-roten Koalition das gelingen, dürfte der erste Durchgang der Kanzlerwahl bald in Vergessenheit geraten. Ohnehin dürfte eine andere Frage sowohl die Bevölkerung insgesamt als auch die Unternehmen unseres Landes weit stärker umtreiben: Kommt es nun zu den vielen überfälligen Reformen und zur Auflösung des langanhaltenden Investitionsstaus?
Vor diesem Hintergrund wollen wir uns im Speziellen der wichtigen Fragen der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für den Auf- und Ausbau von Energieprojekten und bezogen auf den Anlagenbau widmen. Hierzu sprachen wir mit einem ausgewiesenen Fachmann, der sich insbesondere aus juristischer Sicht seit Jahren mit der Thematik befasst:
Dr. Eric Decker ist Partner und Rechtsanwalt bei der auf Anlagenbau, Energie und Infrastrukturprojekte spezialisierten Kanzlei COMINDIS PartG mbB in Düsseldorf.
HDT-Journal: Herr Dr. Decker, als wir vor einiger Zeit mit einem Experten für die Planung von Onshore-Windparks sprachen, erfuhr unsere Leserschaft aus erster Hand, gegen welche „Windmühlen“ Windkraft-Projektentwickler kämpfen müssen. Die Rede war von 36.000 Seiten Papier für jedes einzelne Objekt. Goethes gesammelte Werke in der Hamburger Ausgabe kämen mit einem Drittel des Volumens aus. Ist, was die Entbürokratisierung anbelangt, unser Land nicht geradezu zum Erfolg verdammt?
Eric Decker: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Die Bürokratie ist im Bereich des Anlagenbaus, insbesondere bei großen Infrastruktur- und Energieprojekten, wie etwa Chemieanlagen, Onshore- und Offshore-Windparks, Brücken, Tunneln et cetera, ein erhebliches Hindernis. Wir kennen die damit verbundenen Schwierigkeiten nur zu gut aus unserer Beratungspraxis. Die Vielzahl an Genehmigungs- und Prüfverfahren führen dazu, dass der gesamte Prozess nicht nur langwierig, sondern auch sehr komplex und kostspielig ist. Dies betrifft zum Beispiel Planfeststellungsverfahren, Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz oder auch Baugenehmigungen, die oftmals viel zu lange dauern. Intensive Prüfungen der Umweltverträglichkeit, des Naturschutzes, des Wasserrechts, des BImschG, einschließlich einer Beteiligung der Öffentlichkeit, sind notwendig. Ferner ergeben sich bei öffentlichen Aufträgen oft vergaberechtliche Probleme.
Viele dieser Anforderungen sind wichtig, um sicherzustellen, dass Projekte nachhaltig und umwelt- sowie sozialverträglich sind. Aber der bürokratische und zeitliche Aufwand ist oft unverhältnismäßig. Hier sind zweifellos Reformen notwendig.
Die Herausforderung liegt darin, die richtige Balance zu finden – einerseits den erforderlichen Schutz und die Transparenz zu gewährleisten und andererseits den rechtlichen und administrativen Aufwand für die Industrie auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Ein Schritt in die richtige Richtung wären vereinfachte Genehmigungsprozesse, einstufige Instanzenzüge bei Rechtsmitteln, Erleichterungen im Vergaberecht und die Vereinheitlichung von Vorschriften. So gesehen könnte man tatsächlich sagen, dass Deutschland, als führender Industriestandort und Vorreiter in der Energiewende, in der Entbürokratisierung durchaus noch erhebliches Potenzial für einen „Erfolg“ hat – aber das erfordert eine tiefgehende Reform der Verwaltungsstrukturen.
HDT-Journal: Welche Impulse versprechen Sie sich von der neuen Bundesregierung? Lässt der Koalitionsvertrag bereits konkrete Änderungen im Hinblick auf Genehmigungsverfahren erahnen?
Eric Decker: Ich verspreche mir eine deutliche Vereinfachung, aber auch eine Änderung des „Mindsets“. Oftmals sind es nicht nur die Vorschriften und Verfahren, die komplex sind. Auch die Anwendung durch die Verwaltung erfolgt überkritisch und nicht im Sinne einer „Projektermöglichung“, soll heißen: unter Ausnutzung vorhandener Ermessensspielräume.
Die Koalition aus Union und SPD widmet dem Thema Genehmigungen in ihrem Koalitionsvertrag eine eigene Überschrift. Das Umweltgenehmigungsrecht soll vereinfacht werden. Hierzu sollen Bürokratie abgebaut und Verfahren beschleunigt und vereinfacht werden – insbesondere durch die Einführung von klaren Fristen und Typengenehmigungen. Der Koalitionsvertrag sieht auch eine Reform zur Vereinfachung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vor. Innerhalb der europarechtlichen Spielräume sollen Schwellenwerte für eine UVP-Pflicht angehoben werden. Außerdem möchte die Koalition prüfen, inwiefern eine Aussetzung der UVP-Vorprüfung für Änderungsgenehmigungen möglich ist. Auch eine Überprüfung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und eine Verschlankung des Umwelt-Informationsgesetzes strebt die neue Regierung an.
Mit bloßen Absichtserklärungen ist dabei natürlich noch nichts gewonnen. Es ist auch zweifelhaft, ob die im Koalitionsvertrag genannten Maßnahmen für eine merkliche Beschleunigung von Verfahren ausreichend sind. Aber: sie zeigen zumindest, dass den Koalitionspartnern das Problem langwieriger Genehmigungsverfahren als Bremse bei der Energiewende und Dekarbonisierung der Industrie bewusst ist. Die genannten Maßnahmen sind daher ohne Zweifel ein begrüßenswerter erster Schritt.
HDT-Journal: Wir wollen hier nicht in Richtung Plattitüde abrutschen und vom Krieg als Vater aller Dinge reden. Allerdings bewies der infolge der Zeitenwende nötig und möglich gewordene Aufbau von LNG-Terminals in Rekordzeit, dass sich in Deutschland Projekte durchaus zeitnah umsetzen lassen. Sehen Sie hierin eine Blaupause für die generelle Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für Energieprojekte und den Anlagenbau?
Eric Decker: In der Tat: Der bemerkenswert schnelle Aufbau von LNG-Terminals hat gezeigt, dass Deutschland prinzipiell in der Lage ist, in einer Notsituation auch komplexe Infrastrukturprojekte innerhalb kurzer Zeiträume umzusetzen. Der Gesetzgeber hat angesichts der Krise der Gasversorgung mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz die notwendigen Hebel gefunden. Dies waren vor allem Ausnahmen von der UVP-Prüfung, Vereinfachungen im Immissionsschutz-, Naturschutz- und Vergaberecht. Es beruhigt, dass Planungsprozesse beschleunigt und bürokratische Hürden überwunden werden können, wenn es für die Sicherstellung der Energieversorgung darauf ankommt.
Schwieriger ist es, die Krisensituation der Gasversorgung im Jahr 2022 / 2023 auf andere Anlagenbauprojekte pauschal im Sinne einer Blaupause zu übertragen. Denn in einem bereits regulierten Umfeld bedarf es sorgfältiger Analysen, inwieweit Einschnitte (zum Beispiel Verkürzung von Auslegungs- oder Einspruchsfristen) verhältnismäßig und EU-rechtskonform sind. Im „Normalbetrieb“ sind grundlegende rechtliche und gesellschaftliche Prinzipien – insbesondere der Umwelt- und Naturschutz – zudem stärker zu berücksichtigen als dies im Rahmen der LNG-Projekte teilweise der Fall war. Zudem ist in Zeiten, in denen Anlagenbauprojekte nicht so akut sind, wie das bei den LNG-Terminals der Fall war, mit mehr Widerständen, vor allem von Umweltverbänden, zu rechnen. Dennoch wird am Beispiel LNG-Terminals deutlich, dass mit der richtigen politischen Umsetzung, Analyse und wirtschaftlichen Mobilisierung grundsätzlich eine Beschleunigung von Anlagenbauprojekten möglich ist.
HDT-Journal: Fragt man Planer nach den Hauptursachen für die schleppende Umsetzung wichtiger Infrastrukturprojekte, hört man immer wieder dasselbe Stichwort: Verbandsklagerecht. Manche sprechen hinter vorgehaltener Hand sogar von einer Art „Projektverhinderungs-Industrie“. Rechnen Sie hier ebenfalls mit einer baldigen Reform, die den Weg für das viel zitierte „Deutschland-Tempo“ freigibt?
Eric Decker: Das Verbandsklagerecht ist unbestritten ein scharfes Schwert für Umweltverbände, die Projekte verhindern oder verzögern wollen. In der Praxis kann dies dazu führen, dass Projekte jahrelang in Rechtsstreitigkeiten verstrickt sind, was zu erheblichen Verzögerungen oder gar zum Scheitern führen kann. Auch dieses Feld kennen wir aus eigener Praxis mit den sich anschließenden Fragen der Bauzeitverlängerung, Kostenerhöhung und des Claim-Managements.
Im Koalitionsvertrag ist eine Reform des Verbandsklagerechts vorgesehen. Geplant ist, das Recht zur Erhebung einer Verbandsklage an die „tatsächliche Betroffenheit“ des Verbandes zu koppeln. Auch sonst soll das umweltrechtliche Verbandsklagerecht auf das „europarechtliche Mindestmaß“ reduziert werden. Bislang können Umweltverbände in Deutschland auch dann eine umweltrechtliche Verbandsklage erheben, wenn sie keine Verletzung eigener Rechte geltend machen. Das soll sich ändern. Zukünftig müssten Umweltverbände darlegen, inwiefern sie durch das jeweilige Projekt in eigenen Rechten verletzt werden. Wird die Reform umgesetzt, ist zu erwarten, dass viele der derzeit zulässigen Verbandsklagen künftig an dieser Hürde scheitern.
Ob diese Änderung allein ausreicht, um Genehmigung und Durchführung von Projekten hinreichend zu beschleunigen, bleibt offen. Dies wird auch davon abhängen, inwieweit sich Umweltverbände durch zukünftige Regelungen von Klagen abhalten lassen. Denn auch wenn eine Klage im Zweifel unzulässig ist, bedeutet dies nicht, dass mit der Bearbeitung dieser (unzulässigen) Klage keine Zeit verloren ginge oder keine zusätzliche Belastung für die – bereits überlasteten – Gerichte verursacht würde.
Der Weg zum erhofften „Deutschland-Tempo“ erfordert eine Vielzahl von Maßnahmen zur Entbürokratisierung. Der Gesetzgeber wird genau darauf zu achten haben, Rechtsschutzmöglichkeiten von Einzelpersonen und Umweltverbänden nicht bis hin zur EU-Rechts- oder Verfassungswidrigkeit einzuschränken. Hierdurch würde mehr verzögert als beschleunigt.
HDT-Journal: Kommen wir zu zwei Energieträgern, die bei vielen Menschen ganz unterschiedliche Emotionen auslösen: Kernenergie und Wasserstoff. Beginnen wir mit der Kernenergie. Nach all den Volten aus Ausstieg, Wiedereinstieg und erneutem Ausstieg infolge von Fukushima schien das Thema zuletzt endgültig erledigt zu sein. Womit Deutschland eine relativ exklusive Position einnimmt. Erwarten Sie, dass es bei dem Spagat aus dem Import von ausländischem Atomstrom zur Sicherung der Grundlast bei gleichzeitiger Ablehnung der Technologie bleiben wird?
Eric Decker: Das Thema Kernenergie in Deutschland ist politisch äußerst komplex und emotional aufgeladen. Die politische Debatte – vom Atomausstieg bis zu Überlegungen, diesen aufgrund der Energiekrise wieder zu revidieren – hat zu einem widersprüchlichen Diskurs geführt.
Vor der Bundestagswahl 2025 sind Forderungen nach einem Wiedereinstieg in die Atomenergie wieder lauter geworden. Die Union hatte in ihrem Wahlprogramm zumindest eine fachliche Bestandsaufnahme vorgeschlagen, ob angesichts des Rückbaustadiums eine Wiederaufnahme des Betriebs abgeschalteter Kernkraftwerke unter vertretbaren technischen und finanziellen Aufwand möglich sei.
Ein Wiedereinstieg würde jedoch weiterhin bislang ungelöste Probleme mit sich bringen. Zwar ist das Risiko eines Zwischenfalls in deutschen Atomkraftwerken gering, doch bleibt die Frage der sicheren Endlagerung des Atommülls. Wohl auch aus diesem Grund enthält der Koalitionsvertrag 2025 keine Pläne bezüglich eines etwaigen Wiedereinstiegs oder zur Kernkraft in Deutschland generell. Auch der in Europa erstarkende Sektor der „Small Modular Reactors“ – kleiner modularer Kernenergieanlagen – wird nicht aufgegriffen, obwohl die Union diesen Punkt explizit in ihrem Parteiprogramm hatte. Lediglich zum Thema Fusionskraftwerke enthält der Koalitionsvertrag die kurze Aussage, diese Anlagen sollten außerhalb des Atomrechts reguliert werden. Fusionskraftwerke sind bekanntlich technisch allerdings noch in weiter Ferne.

Wer ist Eric Decker?
Dr. Eric Decker ist seit 1999 als Rechtsanwalt zugelassen. Er ist Partner bei COMINDIS PartG mbB in Düsseldorf. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich Anlagenbau, Energie und Infrastruktur sowohl in der projektbegleitenden Beratung wie der Vertretung vor Schiedsgerichten und ordentlichen Gerichten.
Dr. Decker ist auch als Schiedsrichter tätig und publiziert regelmäßig zu anlagenbau- und energierechtlichen Themenkreisen.
Weitere Informationen:
COMINDIS PartG mbB
www.comindis.com
Dies ungeachtet sieht der Koalitionsvertrag aber die möglichst zeitnahe Schaffung der Rahmenbedingungen für Investitionen in ausreichend gesicherte Leistung und Versorgungssicherheit vor. Hierzu sollen bis 2030 neue Gaskraftwerke mit einer Kapazität von bis zu 20 GW vorrangig an bestehenden Kraftwerkstandorten geschaffen werden. Dies entspricht etwa 40 Kraftwerksblöcken, die künftig als Back-up fungieren sollen, wenn die Erneuerbaren nicht ausreichend Strom liefern. Auffällig ist dabei, dass von einer technologieoffenen Ausschreibung gesprochen wird. In Gesetzesvorhaben der Ampelkoalition aus dem Herbst 2024 wurden noch umfassende Vorgaben zur Wasserstuffnutzung gemacht (sogenannte H2-ready-Gaskraftwerke). Dennoch soll Deutschland „Energieimportland bleiben“. Daher ist zu erwarten, dass auch künftig Atomstrom aus europäischen Nachbarländern importiert wird.
Erwähnen möchte ich noch die Geothermie, die derzeit noch deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Hier sieht der Koalitionsvertrag vor, dass ein verbessertes Geothermiebeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht wird. Ferner sollen geeignete Instrumente zur Absicherung des Fündigkeitsrisikos eingeführt werden. NRW ist hier bereits einen Schritt vorangegangen, mit dem Programm progres.nrw, insbesondere dem Programmbereich Risikoabsicherung hydrothermale Geothermie sowie dem Masterplan Geothermie NRW.
Nicht zu vernachlässigen ist der zeitliche Faktor. Ausschreibungen sind oftmals langwierig und anfällig für rechtliche Auseinandersetzungen. Die Abwicklung derartiger Projekte erfolgt häufig im Konsortium oder Joint Venture. Dies bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung und Verhandlung. Wir beraten hierbei regelmäßig die beteiligten Parteien im Anlagenbau.
HDT-Journal: In Ihrer Arbeit sind Sie auch in Wasserstoff-Projekte involviert. Worauf muss sich die Wasserstoff-Industrie in der neuen Legislaturperiode einstellen?
Eric Decker: Neben anderen anlagenbaulichen Bereichen, wie Waste-to-energy, Raffinerien, Chemieanlagen, Wasserkraftprojekten et cetera ist Wasserstoff ein Themenfeld bei uns. Die Wasserstoff-Industrie wird in der kommenden Legislaturperiode vor entscheidenden Herausforderungen und Chancen stehen. Der Koalitionsvertrag setzt sich einen „schnellen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft“ zum Ziel. Erforderlich dafür ist eine zuverlässige Versorgung mit klimafreundlichem Wasserstoff aus verschiedenen Quellen. Langfristig ist eine Umstellung auf klimaneutralen Wasserstoff beabsichtigt. Dieser soll auf einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien aus dem Inland und aus Importen basieren.
Die Koalition plant, durch Deregulierungen die Erzeugung von Wasserstoff in großen Elektrolyseanlagen sowie dezentral und flächendeckend zu fördern. Dennoch wird Deutschland auch beim Wasserstoff Energieimportland bleiben. Zur Sicherung der Versorgung sollen Energiepartnerschaften und eine grenzüberschreitende Infrastruktur für den Import von Wasserstoff und seinen Derivaten aufgebaut werden. Die Koalition plant insbesondere, alle deutschen und europäischen Häfen anzubinden.
Deutschland soll eine führende Rolle in der europäischen Wasserstoffinitiative einnehmen. Spiegelbildlich sieht die Koalition das deutsche Wasserstoffkernnetz als zentrales Element der Stärkung des Industriestandorts. Deutschland soll als Gesamtbild betrachtet werden. Aus diesem Grund wird die Notwendigkeit betont, die Wasserstoffversorgung im Osten und Süden sicherzustellen. Der Koalitionsvertrag reagiert damit auf die Kritik am geplanten Wasserstoffkernnetz, das in der ersten Ausbauphase mehrere Industriecluster mit mittelgroßen Anlagen in diesen Regionen nicht berücksichtigt.
Um die Ziele des Koalitionsvertrags zu erreichen, sind massive Investitionen und eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Industrie und internationalen Partnern erforderlich. Nur so kann Deutschland seine Rolle als Vorreiter in der europäischen Wasserstoffwirtschaft langfristig sichern und damit einen wichtigen Beitrag zur globalen Energiewende leisten.
HDT-Journal: Herr Dr. Decker, haben Sie vielen Dank für die hoch spannenden Erläuterungen und Perspektiven. Wir wollen hoffen, dass jetzt tatsächlich die nötige Bewegung ins Spiel kommt und sich gleichzeitig auch die vielen Sorgen hinsichtlich weltwirtschaftlicher Aspekte – Zölle und Lieferketten – bald wieder in den Hintergrund treten, wofür ja bereits einiges spricht.
Die Fragen stellte Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal
Bildhinweis:
Unser Titelbild entstand unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz.