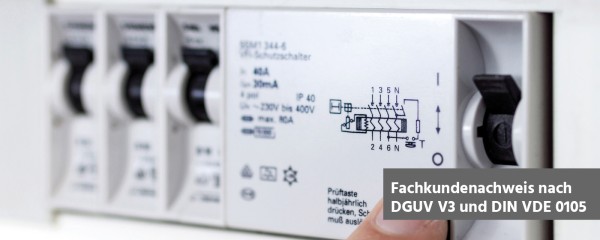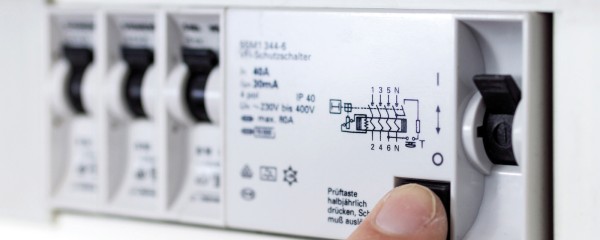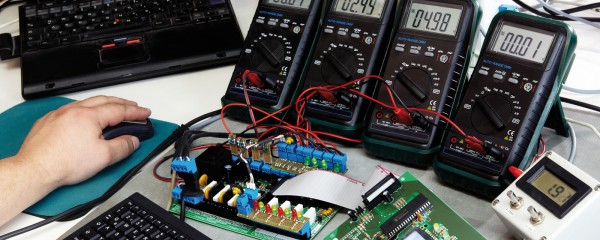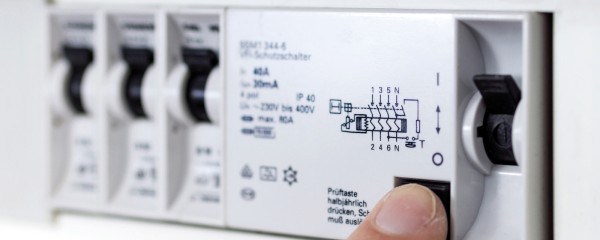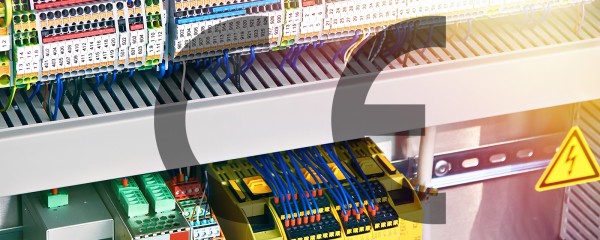Die Seminare im Haus der Technik stehen für eine praxisgerechte und optimierte Wissensvermittlung. In der Weiterbildung werden die aktuellen elektrotechnischen Anforderungen aus der Industrie und dem Gewerbe berücksichtigt. Mit einem Elektrotechnik Seminar im Haus der Technik aus dem großen Angebot an themenspezifischen Weiterbildungen für Elektrofachkräfte sowie für elektrotechnische Laien gewinnen die Seminarteilnehmer an Sicherheit beim Umgang mit elektrischen Anlagen. Die Seminare werden teilweise auch online angeboten.
Die Elektrosicherheit ein wesentlicher Faktor, um störungsfreie Abläufe und einen sicheren Betrieb im Unternehmen zu gewährleisten. Speziell ausgebildete Elektrofachkräfte, sorgen dafür, dass die Normen und VDE-Bestimmungen umgesetzt und Mitarbeiter geschult werden. Sie müssen deshalb ihr Wissen immer wieder auf den aktuellen Stand bringen und sich regelmäßig weiterbilden.
Neu im Angebot sind Seminare und Schulungen zum Thema „Arbeiten unter Spannung“ zum Erwerb des AuS-Passes. Finden Sie hier eine Checkliste für Sicheres Arbeiten unter Spannung (AuS).
Elektrofachkraft (EFK)
Hier eine klare Übersicht, welche Ausbildungen in der Regel direkt zur Elektrofachkraft (EFK) qualifizieren – und welche nicht automatisch ausreichen:
1. Ausbildungen, die in der Regel zur Elektrofachkraft qualifizieren
Nach DIN VDE 1000-10 und DGUV Vorschrift 3 gilt: Eine Person ist Elektrofachkraft, wenn sie
- eine elektrotechnische Berufsausbildung abgeschlossen hat,
- praktische Erfahrung in elektrotechnischen Arbeiten besitzt und
- Kenntnis der Normen & Sicherheitsvorschriften nachweisen kann.
Typische Beispiele für direkt qualifizierende Ausbildungsberufe:
- Elektroniker (alle Fachrichtungen: Energie- und Gebäudetechnik, Automatisierungstechnik, Betriebstechnik, Informations- und Telekommunikationstechnik usw.)
- Elektroinstallateur (ältere Bezeichnung, heute Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik)
- Elektromeister / Elektrotechniker
- Mechatroniker (sofern Ausbildung & Tätigkeit regelmäßig elektrotechnische Arbeiten umfassen und der Arbeitgeber ihn offiziell als EFK bestellt)
- Elektriker für Geräte und Systeme
- Fernmeldetechniker (ältere Bezeichnung, vergleichbar mit Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik)
2. Ausbildungen, die nicht automatisch ausreichen
Es gibt Berufe mit elektrotechnischen Anteilen, die nicht automatisch zur vollen EFK führen, weil der elektrotechnische Anteil zu gering oder zu spezialisiert ist.
Hier ist oft nur der Status „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ (EFKffT) möglich – oder es braucht zusätzliche Qualifikationen.
Beispiele:
- Industriemechaniker → Mechanik steht im Vordergrund, Elektrotechnik nur in Grundzügen
- Zerspanungsmechaniker → kaum elektrotechnische Inhalte
- Anlagenmechaniker (SHK) → Schwerpunkt Sanitär, Heizung, Klima; elektrotechnische Arbeiten nur nach Zusatzqualifikation
- Kfz-Mechatroniker → Elektrotechnik im Kfz-Bereich, keine allgemeine Installationstechnik
- Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik (nur bedingt – Schwerpunkt ist Maschinenservice, oft Zusatzausbildung nötig für Gebäudetechnik)
3. Grenzfälle – abhängig von Zusatzschulungen
Es gibt Berufe, die teilweise die Qualifikationen mitbringen, aber nur in Kombination mit Berufserfahrung oder Zusatzkursen EFK-Status erreichen:
- Mechatroniker (bei überwiegender mechanischer Tätigkeit braucht es Auffrischung)
- Informationselektroniker (bei Schwerpunkt auf IT/Netzwerktechnik ggf. keine Praxis in Starkstromanlagen)
- Elektroniker für Automatisierungstechnik (volle EFK im Automatisierungsbereich, aber z. B. Mittelspannung nur mit Zusatzkurs)
4. Zusatzqualifikationen
Wer keine elektrotechnische Vollausbildung hat, kann EFK werden durch:
- Umschulung zum elektrotechnischen Beruf
- Meister- oder Technikerabschluss im Elektrotechnikbereich
- Qualifizierung zur Elektrofachkraft (z.B. mehrwöchige Kurse nach DGUV & VDE für bestimmte Anwendungsbereiche)
Passende Seminar für Elektrofachkräfte:
- VEFK, verantwortliche Elektrofachkraft
- Messpraxis zur Prüfung elektrischer Anlagen, Geräte, Maschinen und Erdungsanlagen
- Rechtssichere Organisation und Dokumentation in der Elektrotechnik
- Schaltberechtigung
- Expertennetzwerk für Verantwortliche im Elektrobereich
Qualifikationsstufen nach VDE – Übersicht und Bedeutung
Die fachliche Qualifikation, ergänzt durch persönliche und soziale Kompetenzen, ist ein entscheidender Faktor für die sichere Ausführung elektrotechnischer Arbeiten. Um die fachliche Einstufung systematisch vorzunehmen, definiert die VDE verschiedene Qualifikationsstufen mit konkreten Anforderungen.
Grundlage: DIN VDE 1000-10:2021-06
Diese Norm wurde erstmals 1995 veröffentlicht, um die Anforderungen an elektrotechnisch tätige Personen im Sinne des Arbeitsschutzes und der DGUV Vorschrift 3 klar festzulegen. Die aktuelle Fassung ist seit dem 01.06.2021 gültig.
Ziel: Die Norm regelt, welche fachlichen Qualifikationen für bestimmte Tätigkeiten erforderlich sind, insbesondere wenn diese sicherheitsrelevant sind.
Anwendungsbereiche:
- Planung und Projektierung
- Konstruktion
- Personaleinsatz
- Errichtung, Betrieb und Änderung elektrischer Anlagen
- Prüfungen
Qualifikationsstufen im Überblick
Elektrofachkraft (EFK)
Eine Person gilt als Elektrofachkraft, wenn sie:
- über eine einschlägige elektrotechnische Ausbildung (Elektriker Lehre mit Abschluss, Elektrotechnik Studium) verfügt,
- durch Erfahrung und Wissen die übertragenen Aufgaben beurteilen kann,
- in der Lage ist, Gefährdungen zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Wichtig: Der Begriff ist keine Berufsbezeichnung! Auch ein Gesellenbrief allein genügt nicht – regelmäßige Schulungen und Unterweisungen sind zwingend erforderlich, um die aktuelle Regelwerkslage zu kennen und eigenverantwortlich handeln zu können.
Dazu bieten sich folgende Seminare an:
VEFK Verantwortliche Elektrofachkraft und Anlagenbetreiber Elektrotechnik
Aufbau und Praxis einer rechtssicheren Organisationsstruktur im Bereich der Elektrotechnik nach DIN VDE 0105-100 und DIN VDE 1000-10)
Fachkundeerhalt für die Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK)
Organisatorische und fachliche Kenntnisse für die Übernahme von Betreiberverantwortung im Bereich Elektrosicherheit (Jahresunterweisung)
Elektrische Anlagen in der betrieblichen Praxis
DIN VDE 0105-100 Prüffristen und Betreiberverantwortung
Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)
Eine EuP ist keine Fachkraft, sondern wurde von einer EFK in ihre spezifischen Aufgaben eingewiesen. Dabei umfasst die Unterweisung:
- die Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten,
- den sicheren Umgang mit Schutzmaßnahmen und -ausrüstungen,
- ggf. praktische Einweisung.
Typische Einsatzbereiche:
- Hausmeisterdienste
- Bedienpersonal im Schichtbetrieb
Die EuP arbeitet ausschließlich unter Aufsicht einer EFK und darf keine fachlichen Entscheidungen treffen.
Die DIN VDE 0105-100 definiert ergänzend, welche Tätigkeiten eine EuP nach entsprechender Unterweisung übernehmen darf.
Hier geht es zum Seminar.
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT)
Diese Sonderform erlaubt es Handwerkern, wiederkehrende elektrotechnische Tätigkeiten im Rahmen ihres Berufsfelds auszuführen – z. B. das Anschließen eines E-Herds durch einen Küchenmonteur.
Voraussetzung:
- Theoretische und praktische Ausbildung gemäß DGUV Grundsatz 303-001
- Durchführung nur gleichartiger Tätigkeiten
- Einhaltung klar definierter Arbeitsanweisungen
Rechtsgrundlage: § 5 der Handwerksordnung (HWO)
Unternehmerverantwortung: Auswahl und Beauftragung
Elektrofachkräfte (EFK) und EFKffT dürfen im Rahmen ihrer Qualifikation eigenständig arbeiten. Eine EuP hingegen benötigt immer Anleitung und Kontrolle durch eine EFK.
Besonderheit: Falls der Unternehmer selbst nicht in der Lage ist, die elektrotechnischen Gefährdungen und die Kompetenz des Personals zu bewerten, kann er eine fachkundige Person damit beauftragen (§ 13 ArbSchG).
Wichtig: Nach § 130 OWiG trägt der Unternehmer die Verantwortung für die sorgfältige Auswahl geeigneten Fachpersonals – dies schließt auch Unterlassungen mit ein.
Abgrenzung zwischen den Qualifikationsstufen
In der Praxis ist die Abgrenzung zwischen den Qualifikationsstufen oft schwierig. Wichtig ist: Die Bezeichnung "Elektrofachkraft" ist kein Freifahrtschein für alle Tätigkeiten. Niemand kann alle elektrotechnischen Aufgabenbereiche vollständig abdecken (siehe Erläuterung zu 4.3 in der DIN VDE 1000-10:2021-06).
Daher ist die genaue Einordnung, kontinuierliche Schulung und bewusste Auswahl durch den Unternehmer entscheidend für die Sicherheit im Betrieb.
HDT-Angebot zu elektrotechnischer Sicherheit
Alle wichtigen Teilbereiche der elektrotechnischen Sicherheit werden in unseren Seminaren behandelt:
- Messpraktikum Starkstromanlagen und elektrische Geräte (DIN VDE 0100/0105/0113/0413/0701-0702/0751)
- Prüfen von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (BetrSichV, den neuen TRBS und zu aktuellen DIN VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100-410/510/540/600)
- Prüfen Ortsveränderlicher elektrischer Geräte (DIN VDE 0701/0702/0404/0413/0751 und DGUV Vorschrift 3)
- Aufgaben und Kompetenzen der verantwortlichen Elektrofachkraft VEFK
- Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung in der Elektrotechnik (DGUV Vorschrift 3, TRBS 1112, TRBS 1203, TRBS 1201, TRBS 2210)
- Rechtssichere Dokumentation und Fremdvergabe
- Erdungstechnik und elektrischer Explosionsschutz
- EuP - elektrotechnisch unterwiesene Person
- befähigte Person zum Prüfen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
- Expertennetzwerk zur Elektrosicherheit für Verantwortliche im Elektrobereich
- Organisationverschulden und rechtssichere Dokumentation
- Betriebssicherheitsverordnung
- Gefährdungsbeurteilung im Bereich elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
- Elektrische Anlagen – Din VDE 0105-100
- Prüfstrategien zum Prüfen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
- Monitoring und Diagnose von elektrischen Betriebsmitteln während des Betriebs
- SF6 (Schwefelhexafluorid)-freie Betriebsmittel in Hochspannungsnetzen in der Praxis
- Arbeiten unter Spannung (AuS) bis 1 kV
- Arbeiten unter Spannung im Elektrobereich zum Erwerb des AuS-Passes
- Schutzkonzepte und Schutzprüfungen für regenerative Erzeugungsanlagen
- Prüfen von Ladestationen
- Netzrückwirkungen und Power Quality im Kontext moderner Verteilungsnetze
- Digitalisierung von Ortsnetzstationen im elektrischen Verteilnetz
Seminare zum Prüfen von elektrischen Anlagen, elektrischen Maschinen und elektrischen Geräten
Zahlreiche Prüfungen sind regelmäßig durchzuführen. Das Personal muss dafür befähigt sein und geschult werden. In diesem Bereich bündeln wir unsere Seminare zur Geräteprüfung bzw. zu den ortsveränderlichen Geräten, zur Prüfung an Photovoltaikanlagen, zur Anlagenprüfung, Betriebsmittelprüfung, Isolationsmessung und Erdungsmessung. Dabei geht es immer darum, die Schutzmaßnahmen in Starkstromanlagen und bei elektrischen Geräten einzuhalten. Die verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) muss wissen, was die Mitarbeiter prüfen (wiederkehrende Prüfungen) müssen und dürfen. Unsere Seminare beinhalten meist einen umfangreichen und auswendigen Praxisteil an Geräten. Eigene Messgeräte können mitgebracht werden. Es geht also um die Aus- und Weiterbildung (VDE Prüfung) zur befähigten Person nach BetrSichV, TRBS und der DGUV Vorschrift 3 (BGV A3).
Befähigte Person zur Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte
Für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte ist der Unternehmer gemäß Betriebssicherheitsverordnung, DGUV Vorschrift 3 (vormals BGV A3) und DIN VDE 0701 -0702 für das regelmäßige Prüfen aller im Unternehmen vorhandenen ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel verantwortlich.
Auf der Grundlage der neuen Berufsgenossenschaftlichen DGUV Information 203-071I dürfen wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel nur von befähigten Personen durchgeführt werden. Die erforderliche Qualifikations-stufe ist die der Elektrofachkraft. Die elektrotechnisch unterwiesene Person darf al-lein keine rechtsverbindlichen Prüfungen mehr durchführen. Diese Prüfungen dürfen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft auch von elektrotechnisch unterwiesenen Personen (euP) vorgenommen werden.
Die Be- und Auswertung der Prüfergebnisse unterliegt der Verantwortung der Befähigten Person. Dies ist durch geeignete Maßnahmen (eigenes Personal oder Hin-zuziehung einer Elektrofachkraft) sicherzustellen. Die hier angebotene Ausbildung zur Befähigten Person erfüllt diese Forderung.
Für elektrotechnische Laien empfiehlt sich also zuerst eine elektrotechnische Grundausbildung (Seminare dazu finden Sie hier) sowie der Besuch der Seminare zur elektrotechnisch unterwiesenen Person (euP). Diese Seminare zur Weiterbildung werden im Haus der Technik angeboten.
Durch praktische Messungen an verschiedenen Geräten erlernen die Teilnehmer den genauen Prüfablauf, den Einsatz geeigneter Messgeräte sowie die Auswertung der Messergebnisse. 5 oder 10 Stunden Prüfpraxis werden je nach Seminar geübt.
Welche Bedeutung haben ortsveränderliche Betriebsmittel in der Elektrotechnik und welche Rolle spielen sie in Unternehmen und Industrie?
Ortsveränderliche Betriebsmittel sind elektrische Geräte und Maschinen, die nicht fest installiert sind und leicht an verschiedenen Standorten verwendet werden können. Sie sind in Unternehmen und Industrie unverzichtbar, da sie eine hohe Flexibilität ermöglichen und vielseitig einsetzbar sind. Typische Beispiele sind Laptops, Werkzeuge, Bürogeräte und elektrische Geräte in der Produktion.
Welche Sicherheitsaspekte sind bei der Verwendung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln zu beachten, und wie können Unternehmen sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden?
Die Sicherheit von ortsveränderlichen Betriebsmitteln ist von großer Bedeutung, da sie direkt von Mitarbeitern verwendet werden. Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Betriebsmittel regelmäßig auf ihre elektrische Sicherheit geprüft werden, um mögliche Gefahren zu erkennen. Hierfür sind wiederkehrende Prüfungen nach DGUV Vorschrift 3 vorgeschrieben. Zusätzlich sollten Mitarbeiter über den sicheren Umgang mit den Betriebsmitteln und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften geschult werden.
Wie sieht die gesetzliche Grundlage für den Umgang mit ortsveränderlichen Betriebsmitteln aus, und welche Verantwortlichkeiten tragen Unternehmen und Arbeitnehmer?
Die gesetzliche Grundlage für den Umgang mit ortsveränderlichen Betriebsmitteln ist in Deutschland in der DGUV Vorschrift 3 (früher BGV A3) geregelt. Unternehmen sind dafür verantwortlich, dass die Betriebsmittel sicher und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend betrieben werden. Dazu gehören regelmäßige Prüfungen und die Bereitstellung von geschultem Personal. Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Betriebsmittel fachgerecht zu verwenden und auf mögliche Gefahren hinzuweisen.
Welche Bedeutung hat das Prüfen von ortsveränderlichen Betriebsmitteln, und welche Vorteile ergeben sich daraus für die Sicherheit am Arbeitsplatz?
Das Prüfen von ortsveränderlichen Betriebsmitteln ist ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung. Durch regelmäßige Prüfungen wird sichergestellt, dass die Betriebsmittel elektrisch sicher sind und keine Gefahr für die Mitarbeiter darstellen. Dies trägt dazu bei, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen.
Wie werden Prüfungen von ortsveränderlichen Betriebsmitteln durchgeführt, und welche Qualifikationen benötigen Personen, die diese Prüfungen durchführen?
Prüfungen von ortsveränderlichen Betriebsmitteln werden in der Regel von Elektrofachkräften durchgeführt, die über die erforderlichen Fachkenntnisse und Qualifikationen verfügen. Die Prüfungen erfolgen in der Regel durch Messungen und Sichtkontrollen, um die elektrische Sicherheit der Betriebsmittel zu überprüfen. Die Ergebnisse werden in einem Prüfprotokoll dokumentiert.
Welche Rolle spielen moderne Technologien und Digitalisierung bei der Prüfung und Verwaltung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln?
Moderne Technologien und Digitalisierung spielen eine immer größere Rolle bei der Prüfung und Verwaltung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln. Mobile Apps und Softwarelösungen erleichtern die Durchführung von Prüfungen und die Dokumentation der Ergebnisse. Zudem ermöglichen digitale Plattformen eine effiziente Verwaltung und Organisation der Betriebsmittel, um den Prüfprozess zu optimieren.
Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre ortsveränderlichen Betriebsmittel den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen und den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden?
Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie eine regelmäßige Prüfung ihrer ortsveränderlichen Betriebsmittel durchführen lassen. Dazu sollten sie mit qualifizierten Dienstleistern zusammenarbeiten, die die Prüfungen gemäß DGUV Vorschrift 3 oder vergleichbaren Standards durchführen. Zusätzlich ist eine umfassende Schulung der Mitarbeiter im sicheren Umgang mit den Betriebsmitteln und den geltenden Sicherheitsvorschriften unerlässlich.
Seminare zur elektrotechnisch unterwiesenen Person EuP
Wenn elektrotechnische Laien in der Industrie einfache Arbeiten an elektrotechnischen Anlagen und Betriebsmitteln durchführen sollen, ist eine umfassende elektrotechnische Unterweisung erforderlich. Die EuP darf allerdings diese elektrotechnischen Arbeiten nur unter Leitung und Aufsicht einer (übergeordneten) Elektrofachkraft ausführen. Sie wird von der Elektrofachkraft über die auszuführenden Aufgaben und den damit verbundenen Gefährdungen unterwiesen.
Das Seminar elektrotechnisch unterwiesene Person EuP wendet sich an Mitarbeiter ohne elektrotechnische Ausbildung (Nicht-Elektrotechniker), die sich bedingt durch ihr Aufgabenfeld in elektrischen Betriebsbereichen oder Betriebsräumen aufhalten müssen und an bzw. mit elektrischen Betriebsmitteln arbeiten.
Seminare zur Verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK)
Wie werde ich VEFK?
Für die verantwortliche fachliche Leitung elektrotechnischer Betreibsteile oder sogar aller elektrotechnischen Einrichtungen eines Betriebes ist nach DIN VDE 1000-10 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Techniker, Meister, Diplom-Ingenieur, Bachelor oder Master aus dem Berufsfeld Elektrotechnik notwendig. Für die Beauftragung zur Verantwortlichen Elektrofachkraft wird die Schriftform nicht verlangt. Die Delegation der Verantwortung legt aber im Sinn des rechtssicheren Unternehmens die Schriftform nahe.
Beauftragung einer Verantwortlichen Elektrofachkraft?
Aus der DIN VDE 1000-10 ergeben sich die Aufgaben. Das sind die Beauftragung selbst, der Umfang der übertragenen Pflichten und der Name der VEFK. Weiterhin ist es sinnvoll, den Bestellbereich, die Aufgaben und die Grundlagen der Bestellung zu nennen. Auch die persönliche und fachliche Voraussetzung sollten genannt werden.
Was ist oder wer ist eine verantwortliche Elektrofachkraft?
Eine verantwortliche Elektrofachkraft übernimmt die Fach- und Aufsichtsverantwortung in einem elektrotechnischen Betrieb oder Betriebsteil. Sie wird dazu vom Unternehmer bzw. Fachvorgesetzen beauftragt (DIN VDE 0100-10).
Wann ist eine VEFK erforderlich?
Eine verantwortliche Elektrofachkraft ist notwendig, wenn ein elektrotechnischer Betriebsteil zu leiten ist oder wenn es um Fach- und Aufsichtsverantwortung geht.
Welche Aufgaben hat eine verantwortliche Elektrofachkraft?
Die Aufgaben sind vielfältig und betreffen die Kontrolle bei Planung, Errichtung und Betrieb von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln. Die Verantwortung im Bereich Elektrosicherheit verlangt die Festlegung und Überwachung der Prüfzyklen für ortsfeste und ortsveränderliche Betriebsmittel (https://www.hdt.de/messpraktikum-geraetepruefung-pruefen-ortsveraenderlicher-elektrischer-geraete-h010052198<). Auch die Kontrolle von Auswahl und Einsatz von im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen gehört dazu.
Eine VEFK ist in allen Fragen, welche die Einhaltung der elektrotechnischen Sicherheitsfestlegungen betreffen, weisungsfrei.
Wer braucht eine verantwortliche Elektrofachkraft?
Unternehmen, die unter den Geltungsbereich der DIN VDE 1000–10 fallen, sollte eine verantwortliche Elektrofachkraft bestellen. Die DGUV Vorschrift 3 beschreibt Leitungs- und Aufsichtsaufgaben, die an eine Elektrofachkraft übertragen werden und diese somit zur verantwortlichen Elektrofachkraft machen.
Wer darf Elektrische Anlagen in Betrieb nehmen?
Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten dürfen nur durch Elektrofachkräfte und EuPs oder in deren Begleitung betreten werden.
Welche Verantwortlichkeiten und Aufgaben umfasst die Rolle einer Verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) in einem Unternehmen oder einer Organisation im Bereich der Elektrotechnik?
Die Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) trägt eine entscheidende Rolle, um die Sicherheit elektrischer Anlagen und Systeme in einem Unternehmen zu gewährleisten. Dazu gehören die regelmäßige Inspektion, Instandhaltung und Wartung elektrischer Anlagen sowie die Gefahrenanalyse und Risikobewertung im Umgang mit Elektrizität. Die VEFK ist verantwortlich für die Einhaltung der relevanten Vorschriften, Normen und Gesetze und stellt sicher, dass alle Mitarbeiter, die mit elektrischen Anlagen arbeiten, über die notwendige Qualifikation und Unterweisung verfügen.
Wie wichtig ist die Qualifikation und Weiterbildung einer VEFK, um die Sicherheit und den reibungslosen Betrieb elektrischer Anlagen und Systeme zu gewährleisten?
Die Qualifikation und kontinuierliche Weiterbildung einer VEFK sind von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit und den störungsfreien Betrieb elektrischer Anlagen. Eine umfassende Ausbildung in der Elektrotechnik und umfangreiches Fachwissen über die relevanten Vorschriften und Normen sind unerlässlich. Durch regelmäßige Fortbildungen und Schulungen bleibt die VEFK auf dem neuesten Stand der Technik und kann ihre Verantwortung effektiv wahrnehmen, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.
Welche rechtlichen und normativen Rahmenbedingungen sind für eine VEFK in der Elektrotechnik relevant, und wie beeinflussen sie die tägliche Arbeit?
Die Arbeit einer VEFK ist stark durch rechtliche und normative Rahmenbedingungen geprägt. Dazu gehören beispielsweise das Arbeitsschutzgesetz, die Betriebssicherheitsverordnung und die DIN VDE Normen im Bereich Elektrotechnik. Diese Vorschriften definieren die Pflichten und Verantwortlichkeiten einer VEFK und legen Standards für den sicheren Betrieb elektrischer Anlagen fest. Die VEFK muss sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden und relevante Dokumentationen und Prüfprotokolle geführt werden, um die Einhaltung der Normen nachzuweisen.
Inwieweit spielt die Gefahrenanalyse und Risikobewertung eine Rolle bei der Arbeit einer VEFK, und welche Methoden werden angewendet, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu minimieren?
Die Gefahrenanalyse und Risikobewertung ist eine zentrale Aufgabe einer VEFK. Sie identifiziert mögliche Gefahrenquellen und bewertet die damit verbundenen Risiken im Umgang mit elektrischen Anlagen. Hierbei werden verschiedene Methoden wie beispielsweise die Fehlerbaumanalyse oder die FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) angewendet. Durch diese Analyse können gezielte Maßnahmen ergriffen werden, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und durch präventive Maßnahmen zu minimieren.
Welche Best Practices und Empfehlungen gibt es für eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen einer VEFK und anderen Mitarbeitern im Unternehmen, die mit elektrischen Anlagen arbeiten?
Eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit sind essentiell für ein sicheres Arbeiten mit elektrischen Anlagen. Die VEFK sollte eine offene und klare Kommunikation pflegen und alle Mitarbeiter über Sicherheitsvorschriften und Verfahrensweisen informieren. Regelmäßige Schulungen und Unterweisungen für die Mitarbeiter sind empfehlenswert, um das Bewusstsein für Elektrosicherheit zu stärken. Die VEFK sollte als Ansprechpartnerin für Fragen und Anliegen rund um Elektrosicherheit zur Verfügung stehen und bei Bedarf auch auf mögliche Risiken hinweisen.
Wie werden Veränderungen oder Erweiterungen von elektrischen Anlagen in Bezug auf Sicherheit und Compliance von einer VEFK bewertet und koordiniert?
Veränderungen oder Erweiterungen von elektrischen Anlagen müssen von der VEFK sorgfältig bewertet und koordiniert werden, um die Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Dies beinhaltet eine gründliche Prüfung der geplanten Änderungen im Hinblick auf die Einhaltung relevanter Normen und Vorschriften. Die VEFK sollte die erforderlichen Schritte zur Sicherstellung der Elektrosicherheit festlegen und gegebenenfalls die notwendigen Genehmigungen und Freigaben einholen, bevor die Veränderungen umgesetzt werden.
Welche Rolle spielt die VEFK bei der Prüfung und Freigabe von Elektroanlagen nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorgaben eingehalten wurden?
Die VEFK hat eine wichtige Rolle bei der Prüfung und Freigabe von Elektroanlagen nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten. Sie überprüft, ob alle relevanten Sicherheitsvorgaben eingehalten wurden und die Anlage wieder ordnungsgemäß funktioniert. Die VEFK führt eine Sichtprüfung, Funktionsprüfungen und gegebenenfalls Messungen durch, um die Sicherheit der Anlage zu verifizieren. Erst nach erfolgreicher Prüfung und Freigabe darf die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.
Welche aktuellen Herausforderungen und Trends sehen Sie für VEFKs in der Elektrotechnikbranche, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung von Anlagen?
Die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung stellen eine Herausforderung für VEFKs dar. Mit der Integration von Smart-Technologien und IoT-Anwendungen in elektrischen Anlagen entstehen neue Sicherheitsaspekte und Anforderungen. VEFKs müssen sich mit den neuesten Technologien vertraut machen und ihre Kenntnisse kontinuierlich erweitern, um die Sicherheit auch in komplexen, automatisierten Systemen
Fortbildung und Fortbildungsnachweise für VEFKs
Die elektrotechnischen Normen ändern sich beständig. Die sich wandelnden technischen Voraussetzungen machen Fortbildung für die VEFK zur Pflicht: https://www.hdt.de/vefk-verantwortliche-elektrofachkraft-und-anlagenbetreiber-elektrotechnik-h010033971.
Das Expertennetzwerk Elektrotechnik eignet sich in idealerweise für diese Fortbildung:
https://expertennetzwerk-elektrotechnik.de/
Seminare zur Elektrofachkraft (EFK)
Eine Person gilt als Elektrofachkraft, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen, die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
Die fachliche Qualifikation als Elektrofachkraft gilt als nachgewiesen, wenn der Mitarbeiter seine Ausbildung z.B. zum Elektroingenieur, Elektrotechniker, Elektromeister oder Elektrogesellen erfolgreich abgeschlossen hat. Alternativ gilt auch eine mehrjährige Tätigkeit mit Ausbildung in Theorie und Praxis, wenn diese von einer Elektrofachkraft überprüft wurde.
Da der Umfang der elektrotechnischen Verantwortung maßgeblich von der Tätigkeits- und Kompetenzzuweisung im Unternehmen abhängig ist, unterscheidet die Norm insbesondere zwischen der verantwortlichen Elektrofachkraft der einfachen Elektrofachkraft (EFK).
Die Seminare zeigen die Fach- und Führungsverantwortung auf, die der verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) für das Gebiet der Elektrotechnik obliegt. Im Seminar werden Wege zur Erfüllung der Verantwortlichkeit aufgezeigt, mit denen eine rechtssichere Organisation der Elektroabteilung im Unternehmen gewährleistet werden kann. Pflichtenübertragung spielt ebenfalls eine Rolle.
Damit die Elektrofachkraft die Gefahren, die vom Strom ausgehen, erkennen und vermeiden kann, braucht er eine geeignete fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung. Dies legen die Europäische Norm EN 50110-1:2008-09-01 Abschnitt 3.2.3 sowie die deutsche DGUV Vorschrift 3 fest.
Zusätzliche Fach- und Führungsverantwortung übernimmt die verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK).
Darüber hinaus gibt es die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT) und die elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP).
Verantwortung und Pflichten des Unternehmers im Rahmen der Elektrosicherheit
Die Beurteilung von Arbeitsbedingungen, das Festlegen geeigneter Schutzmaßnahmen und die Übertragung von Arbeiten an fachlich und persönlich geeignete Personen stellen Unternehmerpflichten dar. Bedient sich der Arbeitgeber nicht dieser Möglichkeit und ist er selbst nicht in der Lage, diese Aufgabe richtig und umfassend zu erfüllen, spricht man von einem Organisationsverschulden nach § 823 BGB.
Besuchen Sie zu diesen Themen das jährlich stattfindende „Expertennetzwerk für Verantwortliche im Elektrobereich“.
Seminare Befähigte Person Elektrische Prüfungen (Elektroprüfung)
Vergleichbarkeit von Elektrofachkraft und befähigter Person
Sind Elektrofachkräfte gemäß BGV A3 und DIN VDE 0105-100 "automatisch" auch befähigte Personen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Technischen Regel für Betriebssicherheit TRBS 1203? In der Praxis herrscht derzeit bei elektrotechnisch ausgebildeten Führungskräften und selbst bei verantwortlichen Elektrofachkräften eine große Unsicherheit bezüglich der oben aufgeworfenen Fragestellung. Die häufigste Antwort auf die Frage der Befähigung lautet lapidar: "Wieso sollte der Mitarbeiter nicht befähigt sein? Er hat doch eine Elektro-Ausbildung absolviert."
Klärung der Vergleichbarkeit bzw. Übertragbarkeit der Begriffe "Elektrofachkraft" und "befähigte Person" im Elektrobereich.
Diese Fachfrage beschäftigt sich mit der Thematik, ob es eine inhaltliche Vergleich-barkeit bzw. Übertragbarkeit zwischen dem etablierten Begriff der "Elektrofachkraft" und dem nicht mehr neuen, aber immer noch nicht umfassend bekannten Begriff der "befähigten Person" im Elektrobereich gibt.
Im elektrotechnischen Bereich wird der Begriff befähigte Person nur eingeschränkt verwendet.
Die konkreten Anforderungen für den Bereich der elektrischen Gefährdungen sind im Abschnitt 3.3 der TRBS 1203 beschrieben, die im Frühjahr 2010 aktualisiert wur-de. Die ausführliche Bezeichnung der befähigten Person für den elektrotechnischen Bereich lautet dort: "befähigte Person für Prüfungen zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen"2. Daran lässt sich bereits ablesen, dass der Begriff der befähigten Person (zumindest derzeit) nur in Verbindung mit elektrischen Prüfungen an-zutreffen ist. Es handelt sich hierbei speziell um die oben erwähnten Prüfungen zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen, die von elektrischen Arbeitsmitteln, wie Geräten, Maschinen und Anlagen, ausgehen können.
Anforderungen an Prüfpersonal im elektrotechnischen Bereich gemäß TRBS 1203
Der Arbeitgeber trägt gemäß Betriebssicherheitsverordnung die Auswahlverantwortung für Personen, die von ihm mit der Durchführung der Prüfungen zur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Anlagen und Arbeitsmittel beauftragt wer-den. Die erforderliche Qualifikation der befähigten Person3 ist an die Berufsausbildung, die Berufserfahrung und die zeitnahe berufliche Tätigkeit gebunden.
Aus diesen Forderungen wird klar, dass zur sicherheitstechnischen Beurteilung elektrischer Arbeitsmittel ‚das können Geräte, Maschinen oder Anlagen sein - dem Grundsatz nach klar die Qualifikationsmerkmale einer Elektrofachkraft mit fundierter fachlicher Ausbildung, mit umfassenden praktischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie mit der Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen - insbesondere auch aus dem Prüfbereich - erforderlich sind. Die TRBS 1203 ergänzt die oben genannten Forderungen um den zeitnahen Einsatz im entsprechenden Tätigkeitsbereich und setzt zudem eine bestimmte Dauer für die Ausübung der Tätigkeit voraus, damit von "Berufserfahrung" gesprochen werden kann.
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die befähigte Person deckt (derzeit) im Vergleich zur Elektrofachkraft nur einen elektrotechnischen Teilbereich ab, näm-ich die Prüfungen zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen und den Einsatz des dazu notwendigen Personals. Eine im elektrotechnischen Prüfgeschäft gut ausgebildete und im praktischen Messen und Prüfen versierte Elektrofachkraft kann gemäß vorstehender Ausführungen vom Unternehmer bzw. Arbeitgeber problemlos zur befähigten Person bestellt werden.
Alle anderen Elektrofachkräfte, die andere betriebliche Aufgabenschwerpunkte haben und dort die Qualifikation einer Elektrofachkraft problemlos erfüllen, können trotzdem nicht (ohne vorherige spezielle Qualifikation) zu befähigten Personen bestellt werden.
An dieser Stelle sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass der Anteil an Mitarbeitern aus den verschiedensten elektrotechnischen Bereichen, die heute den Status einer Elektrofachkraft faktisch noch nicht einmal auf ihr konkretes Aufgabengebiet bezogen erfüllen, bedauerlicherweise zunimmt. Diese Mitarbeiter können dement-sprechend erst recht nicht zur befähigten Person für das Tätigkeitsfeld der elektro-technischen Prüfungen bestellt werden.
Erschwerend kommt häufig hinzu, dass das Messen und Prüfen, das von einer befähigten Person ausgeführt werden muss, nicht in allen Unternehmen ein "Vollzeit-geschäft" ist und aus Sicht des Vorgesetzten im günstigsten Fall "geräuschlos" von der Elektrofachkraft neben deren eigentlichen Aufgabengebiet durchgeführt werden soll.
Befähigte Person und Befähigung für Tätigkeiten
1. Befähigte Person nach der TRBS 1203
ist eine Person mit einer elektrotechnischen Berufsausbildung oder gleichwertig, die elektrische Anlagen oder ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel prüft.
2. Befähigung für Tätigkeiten aus der DGUV Vorschrift 1 §7 (1)
Bei der Übertragung von Aufgaben auf Versicherte hat der Unternehmer je nach Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Versicherten befähigt sind, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden
Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten. Der Unternehmer hat die für bestimmte Tätigkeiten festgelegten Qualifizierungsanforderungen zu berücksichtigen. (2) Der Unternehmer darf Versicherte, die erkennbar nicht in der Lage sind, eine Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere auszuführen, mit dieser Arbeit nicht beschäftigen.
Alle Fragen der betrieblichen und überbetrieblichen Aus-, Weiter- und Fortbildung, die für die betreffenden Elektrofachkräfte von Bedeutung sind, werden behandelt. Wir arbeiten mit erfahrenen Trainern zusammen und setzen moderne Lehr- und Lernmethoden ein. Unsere Teilnehmer kommen meist aus der Industrie. Es sind berufserfahrene Praktiker, die sich schnell und effizient neues Wissen aneignen müssen. Qualität der Wissensvermittlung steht dabei für uns an oberster Stelle. Alle Seminare und Tagungen werden an diesen Ansprüchen gemessen.
Elektrofachkraft Unterweisung und befähigte Person zur Prüfung elektrischer Anlagen
In allen Bereichen des Handwerks und der Industrie, die eine hohe Elektrifizierung aufweisen, wie beispielsweise die Bereiche Sanitär, Heizung, Klima, Versorgungs-technik, Produktions- und Fertigungstechnik etc., lassen sich über die Qualifikation zur elektrotechnisch unterwiesenen Person und zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten die Mitarbeiter fachübergreifend einsetzen. Betriebliche Abläufe werden effizienter gestaltet und somit die interne und externe Kundenzufriedenheit verbessert. Allerdings sind dann entsprechend fundierte Unterweisungen und Ausbildungen (bei der Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten mit theoretischer und schriftlicher Abschlussprüfung) zu planen und durchzuführen. Insbesondere bei diesen Personenkreisen sind durch den Unternehmer Bestellformulare, Tätigkeitsprofile und differenzierte Arbeitsanweisungen zu erstellen.
Die oben dargestellte Abbildung zeigt auch, dass "Elektrofachkraft nicht gleich Elektrofachkraft" ist. Selbst die DIN VDE 1000-10 ("Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen") führt aus, dass es die "Voll-Elektrofach-kraft" nicht geben kann, da die Elektrotechnik insgesamt ein zu großes Feld dar-stellt. Denn jede Elektrofachkraft ist genau genommen nur Fachkraft in ihrem konkreten Arbeitsgebiet. Das gilt selbst für die Qualifikationsstufe der verantwortlichen Elektrofachkraft, denn je nach Unternehmensgröße und Betätigungsbereich kann es erforderlich sein, mehrere verantwortliche Elektrofachkräfte, die jeweils einen Teil des Ganzen abdecken, zu bestellen.
Elektrofachkräfte werden in allen Bereichen in der Industrie und im Handwerk eingesetzt und benötigt. Das gilt für Betriebsgrößen vom Familienunternehmen bis zum großen Konzern.
Um die Elektroexperten der Unternehmen fachlich „auf der Höhe“ zu halten, sind regelmäßige Schulungen notwendig.
Die Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen im übertragenen Aufgabenbereich ist unerlässlich und wird von staatlichen Vorschriften, von berufsgenossenschaftlichen Vorschriften wie auch von den Bestimmungen der privaten Normengeber ge-fordert.
Autor: Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralf Ensmann
VDE-Bestimmungen und Normen für die Elektrofachkraft
Technische Normen sind Regeln der Technik. Sie stehen in der Hierarchie unter den Gesetzen, Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften. Diese grundlegenden VDE-Bestimmungen und Normen sollten in keiner Elektrowerkstatt fehlen:
- VDE 0100 – Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis zu 1.000 V
- VDE 0100-610 – Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1.000 V/Erstprüfung
- DIN EN 50110/VDE 0105-100 – VDE-Bestimmungen für den Betrieb von Starkstromanlagen
- DIN VDE 0104 – Errichten und Betreiben elektrischer Prüfanlagen
- DIN EN 61310-3/VDE 0113-103 – Bestimmungen für die elektrische Ausrüstung von Be- und Verarbeitungsmaschinen mit Nennspannungen bis 1.000 V
- VDE 0141 – VDE-Bestimmungen für Erdungen
- VDE 0165-1 – Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
- VDE 0701-0702 – Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte
Warum gewinnt das Thema Arbeiten unter Spannung (AuS) immer mehr an Bedeutung?
Das Arbeiten unter Spannung – häufig mit „AuS“ abgekürzt – ist heute weit mehr als nur ein Spezialbereich der Elektrotechnik. Es hat sich zu einem zentralen Bestandteil moderner Instandhaltung, Energieversorgung und Anlagensicherheit entwickelt. Die Gründe für die zunehmende Bedeutung lassen sich in mehreren Dimensionen erklären:
Betriebliche Anforderungen: Keine Abschaltungen möglich
Schlagworte: Produktionsausfall vermeiden, Stromabschaltung Kosten, Industrieanlagen Wartung
- In vielen Unternehmen ist eine Abschaltung der Stromversorgung wirtschaftlich nicht vertretbar. Ein ungeplanter Produktionsstillstand kann Schäden in Millionenhöhe verursachen.
- Besonders in der Prozessindustrie, chemischen Industrie oder Rechenzentren ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Pflicht.
- Arbeiten unter Spannung ermöglichen eine präventive Instandhaltung – ohne Betriebsausfälle.
Energiewende, Elektromobilität und Digitalisierung
Schlagworte: Energiewende, Stromnetze, Ladeinfrastruktur, Smart Grid, Erneuerbare Energien
- Der Ausbau von erneuerbaren Energien (z. B. Photovoltaik, Windkraft) führt zu dezentralen Stromnetzen, die häufig bei laufendem Betrieb angepasst werden müssen.
- Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos (E-Mobilität) wächst rasant. Diese Systeme benötigen regelmäßige Wartung – oft im laufenden Betrieb.
- Smart Grids und digital gesteuerte Verteilernetze erhöhen die Komplexität der Energieversorgung. Arbeiten unter Spannung werden hier zur betrieblichen Notwendigkeit, um Systeme stabil zu halten.
Zunehmende Nachfrage nach Schulungen und Zertifizierungen
Schlagworte: AuS Schulung, Arbeiten unter Spannung Ausbildung, Elektrosicherheit Weiterbildung
- Durch neue gesetzliche und betriebliche Anforderungen steigt die Nachfrage nach zertifizierten AuS-Schulungen.
- Viele Unternehmen fordern den Nachweis einer Ausbildung zum Arbeiten unter Spannung gemäß DGUV Regel 103-011 oder DIN VDE 0105-100.
- Diese Fragen werden häufig bei Google gestellt:
- „Wer darf unter Spannung arbeiten?“,
- „AuS Schulung Dauer“,
- „Arbeiten unter Spannung Voraussetzungen“.
Elektrosicherheit und gesetzliche Regelungen
Schlagworte: DGUV Vorschrift 3, VDE 0105, Arbeiten an elektrischen Anlagen, Arbeitsschutz Strom
- Laut DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE 0105-100 ist Arbeiten unter Spannung nur dann zulässig, wenn es „aus betriebstechnischen Gründen erforderlich“ ist – dies trifft immer häufiger zu.
- Schutzmaßnahmen, PSA (Persönliche Schutzausrüstung), Werkzeuge mit Isolierung und genaue Arbeitsanweisungen machen diese Arbeiten heute kontrollierbar und sicher.
- Die Verantwortung liegt beim Elektroverantwortlichen, der sicherstellen muss, dass nur geschultes Fachpersonal solche Tätigkeiten ausführt.
Kritische Infrastrukturen: Strom darf nicht ausfallen
Schlagworte: Stromversorgung Krankenhaus, Arbeiten unter Spannung Energieversorger, Netzstabilität
- Einrichtungen wie Krankenhäuser, Bahnverkehr, Flughäfen oder IT-Rechenzentren dürfen keine Stromunterbrechung riskieren.
- Auch Energieversorger und Netzbetreiber arbeiten zunehmend unter Spannung, um Versorgungsunterbrechungen zu vermeiden.
- Dies erfordert speziell geschultes Personal mit regelmäßigen Unterweisungen nach ArbSchG, BetrSichV und TRBS.
Wachsende Bedeutung für die berufliche Praxis
Schlagworte: Arbeiten unter Spannung Praxisbeispiele, Elektrosicherheit im Betrieb, Arbeitsschutz bei Stromarbeiten
- Arbeiten unter Spannung ist längst kein Ausnahmefall mehr, sondern in vielen Betrieben Teil des normalen Arbeitsalltags.
- Wer im Bereich Elektrotechnik oder Instandhaltung arbeitet, wird zunehmend mit Situationen konfrontiert, in denen spannungsfreies Arbeiten nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist.
- Eine moderne AuS-Schulung vermittelt nicht nur rechtliche Grundlagen, sondern auch praktisches Wissen zu Werkzeugen, Arbeitstechniken und Gefährdungsbeurteilung.
Arbeiten unter Spannung ist Zukunft – mit System und Sicherheit
Die steigende Komplexität technischer Anlagen, die Anforderungen an Versorgungssicherheit, und der gesellschaftliche Wandel zur Elektromobilität und Digitalisierung machen das Arbeiten unter Spannung zu einem Thema mit wachsender Relevanz – für Unternehmen und für Fachkräfte.
Wer sich mit „Arbeiten unter Spannung Schulung“, „Elektrosicherheit Vorschriften“, oder „zertifizierte Ausbildung AuS“ beschäftigt, findet in entsprechenden Weiterbildungen Wissen mit Praxisbezug – und verbessert damit nicht nur seine berufliche Qualifikation, sondern auch die Sicherheit im Betrieb.
Nach bestandener Prüfung wird bei unseren Seminaren ein AuS-Pass ausgestellt.
Hier ist eine ausführliche Checkliste für das Arbeiten unter Spannung (AuS) – ideal für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung im betrieblichen Umfeld oder als Seminarunterlage. Sie orientiert sich an den Vorgaben der DIN VDE 0105-100, der DGUV Regel 103-011, sowie den allgemeinen Regeln der Elektrosicherheit.
Checkliste: Sicheres Arbeiten unter Spannung (AuS)
Grundvoraussetzungen (vor jedem AuS-Einsatz)
- Ist die Arbeit technisch notwendig unter Spannung durchzuführen? (z. B. zur Aufrechterhaltung des Betriebs)
- Wurde eine Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG durchgeführt?
- Liegt eine schriftliche Arbeitsanweisung mit klarer Tätigkeitsbeschreibung vor?
- Ist das Personal speziell ausgebildet, geprüft und befähigt für AuS nach DGUV Regel 103-011?
- Sind alle Arbeitsschutz-Vorgaben (DGUV V3, BetrSichV, TRBS) bekannt und berücksichtigt?
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- PSA vollständig und geprüft (z. B. isolierende Handschuhe, Helm mit Visier, Schutzkleidung, Isoliermatte)?
- PSA nach DIN EN-Normen zugelassen und innerhalb der Prüffrist?
- Werden ausschließlich zertifizierte Werkzeuge mit Isolierung (z. B. VDE-Kennzeichnung) verwendet?
- Wurde die PSA vor jedem Einsatz sicht- und funktionstechnisch überprüft?
Organisation und Teamarbeit
- Sind mindestens zwei Personen vor Ort (eine ausführende, eine sichernde Person)?
- Wurden alle Beteiligten unterwiesen und eingewiesen auf das konkrete Objekt und die Umgebung?
- Ist eine ständige Kommunikation zwischen den Teammitgliedern sichergestellt?
- Ist ein Rettungs- und Notfallplan bekannt und griffbereit?
Vorbereitung der Arbeitsstelle
- Ist der Arbeitsbereich klar markiert, abgesperrt und gesichert (z. B. Warnschilder, Ketten, Flatterband)?
- Ist die Arbeitsstelle trocken, trittsicher und frei von leitfähigen Gegenständen?
- Sind alle benachbarten Anlagenteile spannungsfrei oder abgeschottet?
- Ist ein geeigneter Untergrund (z. B. Isoliermatte) vorhanden?
Durchführung der Arbeiten
- Werden alle Schritte exakt nach der Arbeitsanweisung durchgeführt?
- Wird das Risiko durch Abschirmungen, Abstandshalter oder Schutzplatten reduziert?
- Erfolgt eine dokumentierte Schritt-für-Schritt-Ausführung?
- Sind alle Werkzeuge griffbereit und ordentlich platziert (kein Herunterfallen möglich)?
Abschluss der Arbeiten
- Wurde die Anlage ordnungsgemäß wiederhergestellt, geprüft und dokumentiert?
- Ist die Arbeitsstelle gereinigt und freigegeben?
- Wurden alle Beteiligten abgemeldet und informiert?
- Ist der Einsatz vollständig dokumentiert und archiviert (z.B. im E-Betriebsbuch)?